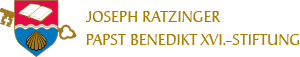[1] „So führt die Kirche in Lehre, Leben und Kult durch die Zeiten weiter und übermittelt allen Geschlechtern alles, was sie selber ist, alles, was sie glaubt“ (DV II 8,1).
[2] „Diese apostolische Überlieferung kennt in der Kirche unter dem Beistand des Heiligen Geistes einen Fortschritt; es wächst nämlich [crescit enim] das Verständnis der überlieferten Dinge und Worte durch das Nachsinnen und Studium der Gläubigen, die sie in ihrem Herzen erwägen […], durch innere Einsicht, die aus geistlicher Erfahrung stammt, durch die Verkündigung derer, die mit der Nachfolge im Bischofsamt das sichere Charisma der Wahrheit empfangen haben; denn die Kirche strebt im Gang der Jahrhunderte ständig der Fülle der göttlichen Wahrheit entgegen, bis an ihr sich Gottes Worte erfüllen“ (DV II 8,2).
[3] Ich zitiere mein Protokoll.
[4] Vgl. H. Verweyen, 1993, 43-46.
[5] Nicht zuletzt im Blick auf die ökumenische Diskussion halte ich bereits die Unterscheidung zwischen „apostolischer Überlieferung“ und einer (nicht näher apostrophierten) „Überlieferung“ für einen Fortschritt. Nur die letztere wird zur Heiligen Schrift in Beziehung gesetzt, aber – anders als auf dem Konzil – dabei nicht mehr als „heilig“ (Sacra Traditio) bezeichnet. Die „apostolische Überlieferung“ umfaßt demgegenüber die Gesamtheit des den Aposteln aufgetragenen, in Worten und Taten abzulegenden Zeugnisses von dem universalen, in Christus offenbar gewordenen Heilswillen Gottes (vgl. Katechismus 2005, Nr. 11). „Die Apostel haben ihren Nachfolgern, den Bischöfen, und durch diese allen Geschlechtern bis zur Vollendung der Zeiten das weitergegeben, was sie von Christus empfangen und vom Heiligen Geist gelernt haben“ (Nr. 12, meine Hervorh.). In diesem Satz gibt es zwei bemerkenswerte Änderungen gegenüber dem Konzilstext (DV II 7). Dort stand: „die Apostel (haben) Bischöfe als ihre Nachfolger zurückgelassen und ihnen ‚ihr eigenes Lehramt überliefert'“. Nun wird, historisch und sachlich präziser, nicht mehr behauptet, daß (zum einen) die Apostel selbst Bischöfe als ihre Nachfolger eingesetzt und (zum anderen) ihnen ihr eigenes Lehramt übertragen hätten. Das an die Stelle von „eigenes Lehramt“ gerückte, nicht näher spezifizierte „das, was sie […] empfangen […] haben“ scheint eher die Verantwortung der Nachfolger der Apostel vor „allen Geschlechtern“ als ihre Lehrgewalt zu betonen. – Der Konzilstext fuhr unmittelbar nach dem Verweis auf die Übertragung des Lehramtes fort: „Diese Heilige Überlieferung und die Heilige Schrift beider Testamente sind gleichsam ein Spiegel, in dem die Kirche Gott […] anschaut […]“. Im „Kompendium“ folgt hingegen nach der Antwort auf die Frage: „Was ist die apostolische Überlieferung?“ (Nr. 12) die Frage danach, auf welche Weisen sie geschieht (Nr. 13). Antwort: „Die apostolische Überlieferung geschieht auf zwei Weisen: durch die lebendige Weitergabe des Wortes Gottes (auch einfach Überlieferung genannt) und durch die Heilige Schrift, in der dieselbe Verkündigung des Heils schriftlich festgehalten wurde“ (meine Hervorh.). Hier scheint die von Geiselmann (und seiner Anhängerschaft auf dem Konzil) vergeblich gesuchte Lösung gelungen, zugleich aber auch Ratzingers frühere Gegenposition klarer zum Ausdruck gebracht. Überlieferung als die „lebendige Weitergabe des Wortes“ geht inhaltlich nicht über das hinaus, was in der Heiligen Schrift niedergeschrieben steht. Sie wird nun tatsächlich der Schrift rein funktional zugeordnet. Beide aber gehen aus einer umfassenden Überlieferung („traditio“), dem apostolischen Verkündigungsgeschehen, hervor, in dem sich fortzeugt, was die „traditio“ als Auslieferung des Sohnes durch den Vater und zugleich als Selbsthingabe Jesu selbst erwirkt hat. – Der folgende Abschnitt über die „Beziehung zwischen der Überlieferung und der Heiligen [!] Schrift“ (Nr. 14), in den gerade noch soviel aus der Konzilskonstitution (DV II 8-9) aufgenommen wurde, wie ohne die Weiterschreibung ökumenischer Ärgernisse möglich war, ist ganz auf dem Hintergrund von Nr. 13 zu lesen. Die Aussage, daß „beide demselben göttlichen Quell entspringen“, ist zwar beibehalten, gibt aber keinen Anlaß mehr zu einem materialen Verständnis der Überlieferung. Man ist versucht anzunehmen, daß Ratzinger selbst noch diesen sorgfältig redigierten Text verfaßt hat. Die althergebrachte, wenn auch im genaueren Blick auf die offiziellen Lehraussagen vergröberte Vorstellung von „der Tradition“ als einem „zweiten Behälter“ von verbindlichen Wahrheiten, in den die Kirche nur hineinzugreifen brauche, wenn die Heilige Schrift nicht genügend Argumente für neu zu erlassende Dogmen hergibt, darf seit dem 29. Juni 2005 jedenfalls als überholt gelten.
[6] In seinen „Erinnerungen“ aus dem Jahre 1998 erwähnt Ratzinger, daß sich „Kardinal Döpfner […] über die ‚konservativen Streifen‘ wunderte, die er (in dieser Rede) wahrgenommen zu haben glaubte“ (1998a, 136).
[7] Vgl. Orientierung 28 (1964) 206.
[8] Schon in einem am 18. Juni 1965 vor der katholischen Studentengemeinde zu Münster gehaltenen Vortrag weist Ratzinger in aller Offenheit auf diese neue Situation hin: „Und da stehen zwischen beiden Mühlsteinen diejenigen […, namentlich genannt wird Hans Urs von Balthasar], die mitgekämpft und mitgelitten haben, daß Erneuerung zustande komme, und fangen an, sich zu fragen, ob die Dinge unter dem Regiment der sogenannten Konservativen nicht immer noch besser standen, als sie unter der Herrschaft des ‚Progressismus‘ stehen können“ (1966d, 91).
[9] Orientierung 28 (1964) 246.
© Wissenschaftliche Buchgesellschaft (WBG)
Im Zeichen des Konzils – die Zeit in Münster (1963-1966)
Aus: Hansjürgen Verweyen, Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.,
Die Entwicklung seines Denkens ( Fünftes Kapitel)
Aus zwei verschiedenen Perspektiven soll in diesem Kapitel ein Zugang zum Verstehen von Ratzingers späterem Denkweg vorbereitet werden. In einem ersten Abschnitt versuche ich, seine damalige Sicht des Verhältnisses von Schrift und Tradition anhand seines Kommentars zum zweiten Kapitel der „Dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung Dei Verbum“ nachzuzeichnen. Im darauffolgenden Abschnitt möchte ich im Blick auf den Verlauf des Zweiten Vatikanischen Konzils selbst und dessen unmittelbare Nachgeschichte einige Gründe für jene gefährliche Polarisierung benennen, die die katholische Theologie in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wie schließlich auch die öffentliche Diskussion um Joseph Ratzinger in dieser Zeit bestimmt hat.
Dei Verbum aus der Sicht Joseph Ratzingers
Spätestens seit der Reformation ist die Frage nach dem rechten Verhältnis von Heiliger Schrift und Tradition zum Grundproblem der Kirche(n) geworden. Diese Tatsache spiegelt sich auch in der Entstehung der „Dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung Dei Verbum“ (abgekürzt: DV) wieder. Vom Anfang bis zum Ende des Konzils wurde hart um die Gestaltung besonders der ersten drei Kapitel gerungen. Einen Monat nach Beginn (11. Oktober 1962) zog Papst Johannes XXIII. den äußerst restaurativ gehaltenen und von einer großen Mehrheit der Konzilsväter zurückgewiesenen Textentwurf „Über die Quellen der Offenbarung [nämlich Schrift und Tradition]“ nach einer Abstimmungspanne persönlich zwecks Neubearbeitung zurück. Knapp zwei Monate vor Abschluß des Konzils (8. Dezember 1965) wurde auf Intervention Papst Pauls VI. ein Satz in den Schlußabschnitt von Artikel 9 aufgenommen, der dem gesamten Text eine zumindest leichte Rückwendung in Richtung auf den ersten Entwurf gibt.
In seinen „Erinnerungen“ von 1998 hat Ratzinger selbst unterstrichen, mit welchem Engagement (im Endeffekt aber doch geringem Erfolg) er sich auf dem Konzil um eine ausgewogene Formulierung der ersten Kapitel bemüht hatte (vgl. 1998a, 106. 128-132). Hier geht es vor allem um ein Problem, das Ratzinger schon seit seinem Theologiestudium bewegt hat: Wie läßt sich die hermeneutische Basis für die Beziehung zwischen Schrift (bzw. Schriftauslegung) und Tradition näher bestimmen? Für diese Frage ist das zweite Kapitel von Dei Verbum, „Die Weitergabe der göttlichen Offenbarung“, von besonderem Gewicht. Ich konzentriere mich im Folgenden auf einige im Kommentar Ratzingers zu diesem Kapitel betonte Sachprobleme und übergehe dabei die Angaben zum Verlauf der Diskussion während des Konzils, soweit diese nicht zur Klärung seiner eigenen Position wichtig sind.
Ratzinger betont, daß bei der Abfassung des zweiten Kapitels die Gedankenführung fortgesetzt wurde, die schon im ersten Kapitel, „Die Offenbarung“, den Neuaufbruch gegenüber dem Ersten Vatikanischen Konzil erkennen ließ: Offenbarung ist Selbstmitteilung Gottes im lebendigen Dialog mit den Menschen, keine bloße Promulgation von Lehren und Vorschriften, denen gegenüber der Glaube zu einem bloßen Für-wahr-halten von Gesetztem verkümmert.
„Für die Frage der Überlieferung ist damit ein wesentlich neuer Ansatzpunkt geschaffen, denn wenn der Ursprung der Überlieferung, das, was am Anfang steht und weitergegeben werden muß, nicht ein promulgiertes Gesetz ist, sondern die Kommunikation in der geschenkten Fülle Gottes, dann muß auch Weitergabe etwas anderes bedeuten als vorher“ (1967, 516).
Im Hinblick auf das Verhältnis von Schrift und Tradition ergibt sich aus dieser neuen Sicht, daß Offenbarung ein Gesagtes und Ungesagtes umfassendes Geschehen ist, „das die Apostel […] nicht völlig ins Wort zu bringen vermögen, sondern das sich in der gesamten von ihnen gesetzten Wirklichkeit christlicher Existenz niederschlägt, die abermals den Rahmen des zu ausdrücklicher Rede Gewordenen weit überschreitet“ (ebd.). Es geht – anders als auf dem Konzil von Trient – nicht mehr um Traditionen im Plural, um das Festhalten an bestimmten kirchlichen Riten und Gebräuchen, sondern um Tradition als einen lebendigen Prozeß der Bezeugung eines Ursprungs, der sich nicht in einer ein für allemal niedergelegten Gestalt fixieren läßt. Das Zweite Vatikanum hat zu diesem Verständnis zurückgefunden, „aber die satzhafte Auffassung von Überlieferung und die daraus folgende quantitative Betrachtungsweise blieben bis zuletzt daneben als Sprengstoff bestehen“ (ebd. 518).
Auf dieser Grundlage übt Ratzinger bei der Kommentierung des achten Artikels scharfe Kritik in zwei Richtungen. (1) Am Ende des ersten Absatzes dieses Artikels „wird (Tradition) mit dem Sein und mit dem Glauben der Kirche identifiziert und so definiert“ (vgl. ebd. 519)[1]. Ratzinger bedauert, daß man nicht dem vor allem durch den US-amerikanischen Kardinal [Albert G.] Meyer vorgebrachten Einwand Raum gegeben habe, „Tradition müsse […] nicht nur affirmativ, sondern auch kritisch betrachtet werden; für diese unerläßliche Traditionskritik stehe als Maßstab die Heilige Schrift zur Verfügung, auf die daher Tradition immer wieder zurückzubeziehen und an der sie zu messen sei“ (ebd. 519f). Zusammenfassend stellt er fest:
„Das Vaticanum II hat in diesem Punkt bedauerlicherweise keinen Fortschritt gebracht, sondern das traditionskritische Moment so gut wie völlig übergangen. Es hat sich damit einer wichtigen Chance des ökumenischen Gesprächs begeben; in der Tat wäre die Herausarbeitung einer positiven Möglichkeit und Notwendigkeit innerkirchlicher Traditionskritik ökumenisch fruchtbarer gewesen als der durchaus fiktiv zu nennende Streit um die quantitative Vollständigkeit der Schrift“ (ebd. 520).
(2) Auf der anderen Seite verteidigt Ratzinger den bereits von den Konzilsvätern heiß diskutierten zweiten Absatz von Art. 8, in dem der dynamische Charakter der Tradition herausgestellt wird[2]. Er streicht heraus, „daß das Voranschreiten des Wortes in der Zeit der Kirche nicht einfach als eine Funktion der Hierarchie angesehen wird. […] In diesem Verstehensvorgang, der die konkrete Vollzugsweise der Überlieferung in der Kirche darstellt, bildet der Dienst des Lehramtes eine Komponente (und zwar, von seinem Sinn her, eine kritische, nicht eine produktive); aber er ist nicht das Ganze“ (ebd. 520). Mit bemerkenswerter Schärfe wendet sich Ratzinger gegen die nach dem Konzil insbesondere von dem protestantischen Theologen Oskar Cullmann erhobene Kritik. Dem von Cullmann betonten Gegenüber von Schrift und Kirche hält er den „heutigen Stand der hermeneutischen Frage“ entgegen (vgl. ebd. 522). Im Hinblick auf die geäußerten Bedenken wichtig sei auch, daß die Schlußpassage von Art. 8 „die Funktion der Tradition ganz auf die Schrift rückbezogen sieht […]. Des weiteren ist Tradition beschrieben als der Vorgang, kraft dessen ‚Litterae‘ [die Schriften] ‚colloquium‘ sind. Diese Doppelbeschreibung der Tradition zeigt sie gänzlich in Funktion zur Schrift hin, sie weist freilich zugleich die Schrift in den Raum von Überlieferung ein“ (ebd. 523). Dieselbe Interpretationslinie wird auch in dem ausführlichen Kommentar zu Artikel 9 verfolgt (ebd. 523-526).
Fraglich bleibt allerdings, ob Ratzingers mehrfach betonte Position, Tradition werde auf diesem Konzil „gänzlich in Funktion zur Schrift hin“ verstanden, wirklich aufrechterhalten werden kann. De facto hat sich besonders in Artikel 9 die Fraktion derer durchgesetzt, die ihre Behauptung eines materialen Nebeneinanders von Schrift und Tradition nicht aufzugeben bereit waren. Gewiß, die Erwähnung von den zwei „fontes“ (Quellen) der Offenbarung wurde vermieden. Wenn „die Heilige Überlieferung und die Heilige Schrift“, „demselben göttlichen Quell (scaturigo) entspringend“, wie zwei Ströme „gewissermaßen in eins zusammenfließen und demselben Ziel zustreben“, so ist hier von einer bloß funktionalen Rolle der Tradition jedoch nichts mehr zu bemerken. Im Blick auf den folgenden Satz bemerkt Ratzinger, es sei wichtig, „daß nur über die Schrift eine eigentliche ‚Ist‘-Definition gegeben wird: Von ihr wird gesagt, daß sie schriftlich festgehaltenes Sprechen Gottes ist. Die Tradition wird dagegen nur funktional beschrieben, von dem her, was sie tut: Sie vermittelt Wort Gottes, ‚ist‘ es aber nicht“ (ebd. 525).
Von einer „Ist“-Definition vermag ich im Text nichts zu erkennen. Vor allem aber läßt doch der (vom Trienter Konzil übernommene) Schlußsatz an einem materialen Nebeneinander von Schrift und Tradition eigentlich keinen Zweifel: beide sollen „mit gleicher Liebe und Achtung angenommen und verehrt werden“. Der aufgrund einer Intervention Papst Pauls VI. davor eingefügte Satz – „nicht aus der Heiligen Schrift allein schöpft (die Kirche ihre Gewißheit über alles Geoffenbarte)“ – greift das Bild von zwei Gewässern, über die sich die Kirche bei der Suche nach Argumenten für ihre Dogmen gleichsam beugt, noch einmal auf und verstärkt somit den Eindruck von einer zweifachen materialen (Vor-)Gegebenheit. In Ratzingers Oberseminar zu der noch „taufrischen“ Offenbarungskonstitution (WS 1965/1966, das letzte, das er vor seinem Wechsel von Münster nach Tübingen gehalten hat) konnte ich nach hartem Kampf meinem Doktorvater nur das Zugeständnis abringen, daß, wenn man den Schlußsatz von Art. 9 noch im Gesamtduktus einer funktionalen Interpretation der Tradition verstehen wolle, man „dann nicht so genau auf den Wortlaut hinsehen“[3] dürfe. – Im übrigen legt doch auch, unmittelbar daran anschließend, der erste Satz von Art. 10 ein materiales Verständnis der Tradition nahe: „Die Heilige Überlieferung und die Heilige Schrift bilden den einen der Kirche überlassenen heiligen Schatz (sacrum depositum) des Wortes Gottes […]“.
Die spätere lehramtliche Entwicklung schien mir Recht zu geben. Im „Katechismus der Katholischen Kirche“ von 1993 war durch die Art der Darstellung von Einzelaussagen des Zweiten Kapitels der Konstitution über die göttliche Offenbarung die dort verbleibende Möglichkeit einer materialen Interpretation des Traditionsbegriffs eher verstärkt als ausgeschlossen worden[4]. Ich war freudig überrascht, daß in dem von Papst Benedikt XVI. (zwei Monate nach seiner Wahl) veröffentlichten „Kompendium“ dieses Katechismus nicht nur keine Bestätigung der sich dort andeutenden restaurativen Tendenz zu finden ist, vielmehr sogar Mehrdeutigkeiten im Konzilstext selbst beseitigt wurden.[5]
Der Mythos der großen Wende
Zu Beginn seiner Tübinger Lehrtätigkeit hat Ratzinger in einer Rede auf dem Bamberger Katholikentag vom Juli 1966 eine erste, von scharfer Kritik geprägte Bilanz des nachkonziliaren Katholizismus gezogen[6]. Unter den Katholiken in Deutschland herrsche „ein gewisses Unbehagen, eine Stimme der Ernüchterung und auch der Enttäuschung, wie sie Augenblicken der Freude und der festlichen Erhebung zu folgen pflegt, in denen mit einemmal die Welt verwandelt schien […] und nach denen uns nur um so schmerzlicher fühlbar wird, wie sehr die Gewöhnlichkeit unser Los und wie sehr der Alltag Alltag geblieben ist“ (1966b, 130). Mir scheint, daß dieser Versuch, die dem Zweiten Vatikanum folgende „Ernüchterung“ einem allgemeinen Genus „Stimmung nach dem Fest“ unterzuordnen, der sehr spezifischen Enttäuschung nach diesem Konzil nicht gerecht wird. Eher könnte man von einer „Sternstunde der Menschheit“ (Stefan Zweig) sprechen – vor deren Ablauf die Jünger Jesu leider wieder einmal eingeschlafen waren (vgl. Mt 26,40).
Aber auch in dieser Sicht der Dinge bliebe das mythische Element verdeckt, das gerade in seiner hintergründigen Wirkkraft der „Sternstunde“ eine recht dunkle Zeit folgen ließ. Ich zitiere zunächst eine längere Passage aus dem Standardwerk des protestantischen Historikers Sidney E. Ahlstrom, „A Religious History of the American People“ (1972, 1079f):
„Den Beginn einer großen puritanischen Epoche [in der nordamerikanischen Geschichte der Religionen] kann man 1558 mit dem Tode von Maria Tudor ansetzen, der letzten Monarchin, die über ein offiziell römisch-katholisches England herrschen sollte, und deren Ende 1960 mit der Wahl von John Fitzgerald Kennedy, des ersten römisch-katholischen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Um denselben Punkt zu unterstreichen, könnte man bemerken, daß die Zeit der Gegenreformation 1563 mit dem Ende des Trienter Konzils begann und 1965 mit dem Abschluß des Zweiten Vatikanischen Konzils endete. […] Ein römischer Katholik wurde zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt – und wurde dann auf dem Gipfel seiner allgemeinen Beliebtheit niedergeschossen und beerdigt, während die Nation und die Welt, halb betäubt von der Folge der Ereignisse, sich zu einer gemeinsamen Trauerklage vereinte, wie sie menschliche Technologie nie zuvor hätte möglich machen können. Unterdes war ein hochbetagter Kardinal, 1958 zum Papst erhoben, dabei, eine Revolution in der römisch-katholischen Kirche durchzuführen, deren Widerhall hin und her durch die christliche Welt rollte, mit Implikationen für die Zukunft, die sich menschlicher Vorausberechnung entziehen.“
Dies alles klingt uns heute wie ein Märchen aus uralter Zeit – sowohl was US-amerikanische Präsidenten als auch die katholische Kirche und „die christliche Welt“ angeht. Daß Ahlstroms elegische Sätze auch die damalige Grundstimmung in Deutschland wiedergeben, läßt sich etwa einem der „Briefe aus Rom“ entnehmen, die Mario von Galli, der angesehenste deutschsprachige Kommentator der Konzilsereignisse, verfaßt hat: Die ewige Wahrheit Gottes, eingesenkt in die Geschichte der Menschen, sei dauernd mit uns unterwegs. Gegenwärtig erscheine sie wie ein Strom, der lange fast spiegelglatt, wie ein See, geglänzt habe. „[…] plötzlich wird alles Bewegung: die Wasser drängen sich durch enge Felsen, stürzen vielleicht in Kaskaden herab“[7].
Mythenbildend war nicht nur die Tatsache, daß der erste katholische Präsident der USA während des Pontifikats eines Papstes zur Regierung kam, der sich wie kaum ein anderer in den Jahrhunderten davor in Wort und Tat zu einschneidenden Reformen in der Kirche anschickte – und dies auf möglichst „demokratischem“ Wege. Die Vermutung liegt nahe, daß das Verhalten dieses Papstes die Gegner J.F. Kennedys bei der Präsidentenwahl in einige Verlegenheit brachte. Im Gegenzug dürfte die Gleichzeitigkeit zweier in der Weltöffentlichkeit so hoch angesehener katholischer Führungspersönlichkeiten es den reformorientierten Bischöfen in der ersten Phase des Konzils erleichtert haben, ultrakonservative Kräfte im Vatikan zu zähmen. Auf jeden Fall hat diese einmalige geschichtliche Konstellation in der westlichen Hemisphäre nicht nur die lange Zeit verstummte Hoffnung zu neuem Leben erweckt, daß es der so viel und mit so viel Recht gescholtenen Christenheit doch noch gelingen könnte, Raum für eine humanere Welt zu schaffen. Diese Konstellation hat auch schlechthin unerfüllbare Erwartungen genährt. Daß aus diesen Erwartungen schließlich hartnäckig verfochtene Forderungen erwuchsen, ist allerdings kaum ohne das unvorhersehbare Zusammentreffen einer Reihe von weiteren Ereignissen zu verstehen, die den „Mythos der großen Wende“ mit einem anderen Vorzeichen versahen. In die Zeitspanne von weniger als einem halben Jahr vor bzw. kurz nach Beginn der zweiten Konzilsphase fielen: der plötzliche Tod Johannes‘ XXIII. (3. Juni 1963), Kennedys berühmte Rede in Berlin (26. Juni 1963) und die Ermordung des amerikanischen Präsidenten (22. November 1963). Nicht vorhersehbar war wohl auch die Art und Weise, wie der neue Papst in dieser spannungsgeladenen Situation während der folgenden Phasen des Konzils und bald danach Schritte unternahm, die man zumindest als zeitlich inopportun, aber auch von der Sache her kaum als besonders dringlich erachten darf. Was hat all dies mit der Thematik dieses Buches zu tun? Mit Kardinal Frings gehörte Joseph Ratzinger zu einer zahlenmäßig wohl nicht besonders großen Gruppe auf dem Konzil, die sich energisch für mutige Schritte nach vorn einsetzte, allerdings mit dem Vorbehalt, daß diese Neuerungen von einer großen Mehrheit der Konzilsväter getragen werden konnten und zu keinem völligen Gesichtsverlust der „Traditionalisten“ führten. Diese Gruppe geriet unter erheblichen Druck, als unter Paul VI. jene Traditionalisten mehr und mehr an Gewicht gewannen und in Reaktion darauf aus der buntgemischten „avantgardistischen Fraktion“ eine Front von Theologen ins Rampenlicht der Medien trat, die ihre Ziele auch unter Inkaufnahme ausbleibender Kompromisse durchzusetzen bereit war[8]. In welcher Richtung sich Ratzinger entschied – und welchen Platz in der nachkonziliaren Geschichte ihm infolgedessen die Öffentlichkeit zuweisen würde –, läßt sich bereits aus seinen Rückblicken auf die einzelnen Sitzungsperioden des Zweiten Vatikanums erschließen.
Wenige Tage vor der Schlußabstimmung über die Kirchenkonstitution im Plenum (November 1964) hatte Paul VI. „Bekanntmachungen“ und eine „Erläuternde Vorbemerkung“ mit der Anweisung erlassen, daß diese dem Text beigegeben werden sollten. Mario von Galli schreibt dazu in seinem „Brief aus Rom“ vom 21. November: „Nein, es hat keinen Sinn, das zu leugnen: die letzte Woche des Konzils war keine Freudenwoche. Die übergroße Mehrheit der Väter erlebte bittere Enttäuschungen, sie fühlte sich behandelt wie ‚Unmündige‘. […] Man hat erlebt, daß eine Gruppe, eine Minderheit, dem Papst näher steht als eine noch so große Mehrheit“[9]. Ratzinger versucht in seinem Rückblick auf diese Ereignisse (1965b, 47-50) zunächst, das Vorgehen Pauls VI. formal-rechtlich wie auch inhaltlich dem Verständnis näherzubringen. Auch er stellt dann allerdings fest:
„Trotz allem bleibt freilich nun auf der anderen Seite bestehen, daß niemand sich eine Wiederholung der Vorgänge der besagten Novemberwoche wünschen kann. Denn sie haben zweifellos gezeigt, daß jene Form der Primatsverwirklichung (und der Formulierung der Primatslehre) noch nicht gefunden ist, die etwa den Kirchen des Ostens deutlich machen könnte, daß eine Vereinigung mit Rom nicht Unterwerfung unter eine päpstliche Monarchie wäre […]“ (ebd. 49f).
Der Abschluß seiner Bemerkungen läßt dann aber keinem Anflug von Skepsis mehr Platz: „Die Vorgänge, von denen wir reden, haben gezeigt, daß Geduld vonnöten ist. Aber sie haben in keiner Weise jene Hoffnung zerstört, ohne welche die Geduld ihre Seele verlöre. Das Konzil und mit ihm die Kirche ist auf dem Weg. Es gibt keinen Grund zur Skepsis und zur Resignation. Aber wir haben allen Grund zur Hoffnung, zur Frohgemutheit, zur Geduld“ (ebd. 50).
Das Klima an der Theologischen Fakultät zu Münster war zu dieser Zeit bereits von einer Hoffnung anderer Art bestimmt. In dem schon zitierten Vortrag vor der Studentengemeinde weist Ratzinger auf zwei Beispiele hin, wo in der Kirchengeschichte nach einem revolutionären Schritt nach vorn schließlich eine Scheidung der Geister nötig wurde. Nicht nur der Apostel Paulus mit seiner Gemeinde in Korinth, sondern auch Martin Luther habe eine solche Erfahrung gemacht, „als während seines Aufenthalts in der Wartburg der Sturm der Erneuerung plötzlich alle Dämme wegzufegen schien und Erneuerung in chaotisches Schwärmertum umzuschlagen begann; selbst in einer so besonnenen Stadt wie Münster spielten sich wenige Jahre später Vorgänge ab, durch die diese Stadt ihren Namen für immer in die Geschichte des christlichen Schwärmertums eingetragen hat“ (1966d, 92; meine Hervorheb.). Eine kaum verdeckte Polemik dieser Art hatte ich vorher noch nicht bei Ratzinger wahrgenommen. Sie umschrieb aber recht treffend den dezenten Hauch atheistischer Ideen Blochscher Prägung, mit dem sich damals Johannes Baptist Metz in Abkehr von der transzendentalen Theologie Karl Rahners und vor seinem Weg in die „Politische Theologie“ umgab.
Das heißt nun allerdings nicht, daß sich Ratzinger in seiner wachsenden Skepsis gegenüber dem allgemeinen Drang zum „weltoffenen Christen“ von seiner Entschiedenheit zu rationaler Glaubensverantwortung verabschiedet hätte. Dies zeigt sehr schön sein 1966 erstmals publizierter Beitrag „Weltoffene Kirche? Überlegungen zur Struktur des Zweiten Vatikanischen Konzils“. Hier schreibt er unter dem Stichwort „Dialog“: „(Die christliche Botschaft) kann als Antwort nur begriffen […] werden, wo zuvor die Frage des Menschseins als Frage erlitten worden ist.“
„Aus diesem Grunde muß einerseits die Frage geweckt werden und muß anderseits die christliche Botschaft sich immer wieder von dem tatsächlichen Fragen der Menschen zu sich selbst hin erwecken lassen, sich vom Hören auf dieses Fragen aus je neu zur Antwort formen“ (1966c, 121). „Weil es im Kerygma immer auch das gibt, was in Wahrheit kein Kerygma, sondern menschliche Umdenkung ist, deshalb ist das geduldige Hören auf das wirkliche Wissen der Menschheit jederzeit wieder vonnöten. […] (Es gibt) auf der einen Seite die Verdunklungen der christlichen Schuld, auf der anderen Seite den verborgenen christlichen Reichtum derer, die ja gleichfalls unter dem Zeichen des Erlösers stehen. Das gilt, wie die Konstitution über die Kirche in der heutigen Welt zu zeigen sich mühte, auch […] für das Verhältnis von Christen und Atheisten; auch der Atheist hat ein Zeugnis zu verwalten, das den Christen angeht, ihn zum Hören und Nachdenken zwingt“ (ebd. 122).
Was den Stellenwert öffentlich-rationaler Glaubensverantwortung für dieses „Hören und Nachdenken“ angeht, bemerkt Ratzinger: „[…] die kirchliche Autorität (kann) nicht den wissenschaftlichen Sachverstand der Theologie ersetzen, sondern muß ihn noch einmal als solchen anerkennen und voraussetzen und kann nur auf ihm aufbauend, nicht gegen ihn die Verkündigung des Wortes und das Geltendmachen seines Anspruchs vollziehen“ (ebd.125).