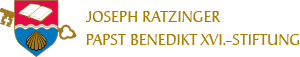IV. LEBEN AUS DEM GEIST (Seite 225-270)
Die geistlichen Implikationen des vorgelegten Ansatzes im theologischen Werk Ratzingers sind zu verstehen als eine Konkretisierung jenes inkarnatorischen Grundanliegens, das bei Joseph Ratzinger aufs engste mit der Schöpfungstheologie verbunden ist. 1. Göttliches Leben
Im Laufe der westlichen Theologiegeschichte kam es zu einer Konzentration auf das Thema der Heilsgeschichte unter weitestgehender Ausblendung des Schöpfungsgedankens, ja, zu einer fast dualistischen Unterscheidung von Gott und Schöpfung, die derart radikal war, daß sie in die Nähe eines Deismus rückte oder in das Konzept einer gottlosen Welt zu führen schien. In der Schöpfungstheologie blieb es letztlich nur bei dem Satz, daß alles in Gott seine erste Ursache hat. Schließlich traten Schöpfung und Kosmos so sehr an den Rand theologischen Mühens und allgemeiner Frömmigkeit, daß der Glaube in die Falle der bloßen Innerlichkeit und Subjektivität zu geraten drohte. Auch kam es, gerade in der Auseinandersetzung mit der Evolutionstheorie, zur Verengung der christlichen Protologie auf die Schöpfung im Anfang („creatio originalis“) und auf den Aspekt des göttlichen „Schaffens“.1 Die Lehre vom göttlichen „Machen“ bzw. die Lehre von der fortgehenden Schöpfung („creatio nova“) wurde kaum thematisiert. Vielmehr wurde die „Schöpfung im Anfang“ verstanden als eine fertige und vollkommene Schöpfung, die keiner weiteren Entfaltung und Evolution bedarf, wie auch das Wort „Schöpfung“ durch seine Endsilbe eher einen abgeschlossenen Vorgang am Anfang als einen Prozeß des Schaffens insinuiert. Vom Menschen schien dasselbe zu gelten: Als einmal geschaffenes und damit fertiges Wesen ist er keiner weiteren Evolution unterworfen. Kurz gesagt, in der Schultheologie blieb es nicht aus, daß das Verhältnis Gottes zu seiner Schöpfung zeitweilig zu einseitig auf die Frage der Kausalität beschränkt wurde.
Martin Heidegger zitierend, wendet Yannaras ein: „Zu diesem Gott (‚causa sui‘) kann der Mensch weder beten, noch kann er ihm opfern. Vor der causa sui kann der Mensch weder aus Scheu auf die Knie fallen noch kann er vor diesem Gott musizieren und tanzen. Demgemäß ist das gottlose Denken, das den Gott der Philosophie, den Gott der causa sui preisgeben muß, dem göttlichen Gott vielleicht näher.“2 Werde – so meint Yannaras – die Beziehung zwischen Gott und dem Kosmos nicht vorrangig personal, sondern vorrangig als Beziehung von Ursache und Wirkung verstanden, so werde Gott abgetrennt von der Welt, und die Welt werde verselbständigt.
Ganz anders die ursprüngliche Sicht der Schöpfung, die bis heute dem Osten eigen ist. Für die Heilige Schrift ist nicht der kausale Begründungszusammenhang der Schöpfung entscheidend, sondern die Einwohnung Gottes, wie sie durch sein Ausruhen in der Schöpfung zum Ausdruck kommt (vgl. Gen 2,2f.). Der siebte Tag des vollendeten Schöpfungswerkes ist der Tag der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes am Sinai (vgl. Ex 24,16): „Erst vom Sinai her wird […] erkennbar, was mit Gottes Schöpfungshandeln ‚am Anfang‘ intendiert war und d.h.: wozu Gott die Welt erschaffen hat: nämlich dazu, Gemeinschaft mit dem Menschen/Israel zu haben.“3 Schließlich kennt die Priesterschrift „eine dynamische, sich selbst übersteigende und auf ein ungeahntes Eschaton hinsteuernde Geschichte“4, deren Ziel das „Wohnen“ des Schöpfergottes inmitten seines Volkes ist. Wie ist diese universale Gegenwart Gottes in seiner Schöpfung bis zum Ende der Zeiten genauer zu verstehen?5
Damit der Mensch wieder alle Dinge der Erde als Ikone Gottes erkennt, heilt Christus vor seinem Heimgang zum Vater die kranken Sinne des Menschen, den Blinden, den Lahmen, den Tauben, den Stummen, und heilt so den Mangel menschlichen Daseins, damit der Geheilte wie jeder seiner Sinne Mächtige aus innerem Erkennen und aus der Klarheit seines kreatürlichen Urteils Ja sagen kann zu Jesus.
Durch die Wiederherstellung seiner leibhaften Sinne erhält der Mensch jene Wachheit im Geist zurück, die ihn erkennen läßt, daß nur härteste Wirklichkeitsbezogenheit zum Glauben führt. Die reiche Entfaltung der Sinne zielt auf kein Genießen wie beim Schlemmer, sondern auf die Differenzierung und kreatürliche Einübung in die Unterscheidung der Geister. Das Geschenk der geheilten Kreatürlichkeit befähigt den Menschen, seinem Herrn in seinem Leben „leibhaft“ zu antworten. Joseph Ratzinger stellt kritisch fest: „Wenn viele sagen, daß eine leiblose Seele zwischen Tod und Auferstehung ein Unding sei, so haben sie offenbar der Heiligen Schrift nicht genau genug zugehört. Denn nach der Himmelfahrt Christi gibt es das Problem der Leiblosigkeit der Seele nicht mehr: Der Leib Christi ist der neue, nun nicht mehr verschlossene Himmel. Wenn wir selber Glieder am Leib Christi geworden sind, dann sind unsere Seelen in diesem Leib festgehalten, der ihr Leib geworden ist, und so warten sie der endgültigen Auferstehung entgegen, in der Gott alles in allem sein wird. Diese Auferstehung am Ende der Geschichte aber ist etwas wirklich Neues.“6
Gotteserkenntnis und -begegnung sind für Joseph Ratzinger keine Fragen der Theorie, sondern der Lebenspraxis. Menschwerdung Gottes heißt, daß sich der Gehorsam des Sohnes gegenüber dem Willen des Vaters in die Welt und in eine konkrete Lebensform inkarniert (vgl. Hebr 10; Ps 40 [39],7-9): Die höchste Erfüllung des Glaubens ist seither nicht mehr das Hören, sondern die „Fleischwerdung“: „Theologie des Wortes wird zur Theologie der Inkarnation. Der Sohn tritt in seiner Hingabe an den Vater aus dem innergöttlichen Gespräch heraus, indem sie zur Hineinnahme und Hingabe der im Menschen zusammengefaßten Schöpfung wird. Der Leib, richtiger: das Menschsein Jesu ist Produkt des Gehorsams, Frucht der antwortenden Liebe des Sohnes; er ist gleichsam konkret gewordenes Gebet. Das Menschsein Jesu ist in diesem Sinn schon ein ganz geistiger Sachverhalt, von seinem Herkommen her ‚göttlich‘.“7
Die Theologie des Leibes ist bei Joseph Ratzinger auf dem Hintergrund seiner Schöpfungstheologie zu verstehen. Mit Bonaventura teilt er die Ansicht, daß der Glaube in seinem universalen Heilsanspruch erfahren wird, sobald der Mensch erkennt, daß alles, was ist, von Gott dem Schöpfer kommt. Wird aber das Leben im Glauben auf das subjektive Gefühl der Innerlichkeit reduziert, so daß jeder empfinden und denken kann, was er will und mag, löst sich die christliche Spiritualität von der objektiven Welt der Materie. Das Leben des Glaubens wird dann dem Bereich des rein Persönlichen zugeordnet und erscheint schließlich als Vertröstung oder Vergrämung menschlicher Existenznot. Ganz anders der biblische Glaube, wie er in der Botschaft von der unbefleckten Empfängnis Mariens und vom leeren Grab zum Ausdruck kommt: Gott kann in der Welt Neues schaffen und in die Welt des Leibes eingreifen. Die Materie ist Gottes, weil von ihm abkünftig. Gott läßt sich nicht auf die Innerlichkeit menschlicher Subjektivität reduzieren, als ob er seinen Platz im Emotional-Subjektiven hätte, während die Welt der Materie anderen, letztlich eigenen Gesetzen gehorcht
Mit diesem christologischen Ansatz finden sich im theologischen Werk Ratzingers zahlreiche Parallelen und Verweise zu Enzykliken seines Vorgängers im päpstlichen Amt. In der Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute „Gaudium et spes“, an der Kardinal Karol Wojtyla wesentlich mitgearbeitet hat, heißt es: „Tatsächlich klärt sich nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes das Geheimnis des Menschen wahrhaft“ (GS 22). Mit der Inkarnation des Gottessohnes erhält die Geschichte der Menschheit ihren unüberbietbaren Höhepunkt. Papst Johannes Paul II. schreibt 1979 in seiner Enzyklika „Redemptor hominis“: „In dieser Heilstat hat die Geschichte des Menschen, so wie sie in der Liebe Gottes geplant ist, ihren Höhepunkt erreicht. Gott ist in die Menschheitsgeschichte eingetreten; als Mensch ist er Subjekt dieser Geschichte geworden, einer von Milliarden und gleichzeitig dieser eine“ (Nr. 1). Der Menschensohn tritt in die Geschichte eines jeden Menschen ein, um ihn seine außergewöhnliche Größe und Würde vor Gott entdecken zu lassen. Papst Johannes Paul II. führt in seiner Enzyklika weiter aus: „Christus ist mit jedem Menschen, ohne Ausnahme, in irgendeiner Weise verbunden“ (Nr. 14). Jeder Mensch ist berufen auf „den Gipfel, der Gott selber ist“, um nach Gottes Bild und Ihm ähnlich sein Leben zu führen.
Gott tritt nicht von außen in die Lebenszeit des Menschen ein. Augustinus spricht vielmehr davon, daß Gott den Menschen auf seinem geistlichen Weg wie ein „Lehrer“ von innen her leitet und führt: „So sollen wir nicht nur glauben, sondern auch zu verstehen beginnen, mit wieviel Recht uns die göttliche Autorität verboten hat, irgend jemand auf Erden unseren Lehrer zu nennen, da es doch nur einen einzigen Lehrer unter allen gibt, der im Himmel ist. Er selbst ist es, der uns belehrt, er, der uns durch die Menschen mit Hilfe äußerer Zeichen unterweist, damit wir, nach ihnen zu ihm zurückgekehrt, uns seine Lehren zu eigen machen.“8 Was der einzelne aus seinem Leben macht, welchen Weg er einzuschlagen und wie er in der Zeit zu leben hat, ist ihm ins Herz geschrieben, und dort hat er es zu suchen und zu entziffern.
Im Hören auf den „inwendigen Lehrer“ lernt der einzelne, sein Leben dem Geist Jesu anzugleichen. Hierzu schreibt Romano Guardini: „In jedem Christen lebt Christus gleichsam sein Leben neu: er ist zuerst Kind und reift dann heran, bis er das volle Alter des mündigen Christen erreicht. Darin aber wächst er, daß der Glaube wächst, die Liebe erstarkt, der Christ sich immer klarer seines Christseins bewußt wird und mit immer größerer Tiefe und Verantwortung sein christliches Dasein lebt.“9 Mit Bezug auf Eph 4,13 bemerkt Romano Guardini über das Heranreifen der Glaubenden zum Vollalter Christi: „Unerhörter Gedanke! Erträglich nur im Glauben, daß Christus wirklich der Inbegriff ist; und in der Liebe, die mit ihm eins werden will. Oder wäre der Gedanke, mit einem zusammengefügt zu sein – nicht nur verbunden im Leben und im Tun, sondern in eins gewachsen in Sein und Selbst – zu ertragen, falls er nicht als Jener geliebt würde, durch den ich mein eigentliches Ich finde, das des Kindes Gottes und mein eigentliches Du, nämlich den Vater?10 Der „alte Mensch“ wird vom „neuen Menschen“, der „aus Christus gebildet“ ist, überwunden, denn Christus wohnt der Lebenszeit eines jeden ein. In Eph 3,17 heißt es hierzu: auf „daß Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und daß ihr in der Liebe fest verwurzelt und gegründet seid“. Das innere Formgesetz menschlichen Daseins wie auch der ganzen Geschichte ist demnach das Leben Jesu.
Joseph Ratzinger stützt den Ansatz seiner Geschichtstheologie auf Bonaventura, für den das Verbum incarnatum die Mitte aller Zeitabläufe ist. Anders als bei Augustinus, über den er seine Doktorarbeit schreibt, heißt es in Ratzingers Habilitationsschrift: „Für das augustinische Schema ist Christus der Zeiten Ende, für das bonaventuranische ist er der Zeiten Mitte.“11 Christus setzt in und mit seinem Leben das Höchstmaß aller Erfüllung in der Zeit: „Bonaventura glaubt an ein neues Heil in der Geschichte, innerhalb der Grenzen der Weltzeit. Diese schwerwiegende Wandlung des Geschichtsverständnisses wird man als das geschichtstheologische Zentralproblem des Hexaëmeron bezeichnen müssen.“12
Das Christentum steht in einer Geschichte, in die das Göttliche selbst verflochten ist, ja, sie ist eine göttliche Geschichte. Der christliche Glaube erschöpft sich nicht in einer Lehre, sondern ist Wirklichkeit, Sache mit objektiver Seinsmacht. Denn mit der Inkarnation wird eine neue Zeitdimension der Geschichte offenbar. Das Leben Jesu verläuft klein und partikulär: in einem kleinen Land, an unbedeutenden Orten, mit einer öffentlichen Verkündigungstätigkeit von höchstens drei Jahren, Ermordung in jungem Alter. Jesus war kein Gelehrter, kein Professor, kein Priester, kein Genie. Von diesem partikulären Jesus bekennen wir, er sei von zentraler und universaler, eschatologischer und kosmischer Bedeutung.13 In der Menschwerdung des Gottessohnes und in den Jahren seines verborgenen und öffentlichen Lebens, im Kreuzestod und in der Auferstehung des Menschensohnes ist Gott in die Geschichte eingegangen, so daß die Alltäglichkeit menschlichen Lebens in die ewige Geschichte des dreieinigen Lebens aufgenommen ist.
Die Berechtigung für ein solches Zeitverständnis ergibt sich aus der überzeitlichen Bedeutung der Menschheit Jesu. Die Zeit des Herrn in Nazareth, sein Aufenthalt im Tempel, der Empfang der Taufe durch Johannes, sein Leiden am Kreuz und sein Sieg in der Auferstehung lassen in der Zeit für immer die göttliche Wahrheit offenbar werden. Einmal als Mensch geboren, bleibt Christus das ewige Kind, das alle Formen und Stadien seines irdischen Kindseins in die Ewigkeit aufgehoben und gerettet hat, denn schon seine irdische Kindheit ist eine Offenbarung seiner himmlischen. Gleiches läßt sich von seinem ganzen Leben sagen, bis hin zum Tod am Kreuz: Er hängt nicht mehr am Kreuz, aber sein Tod und seine Himmelfahrt führen zum Durchbruch der Zeit in die Ewigkeit und des Ewigen ins Zeitliche.
Mit dem Kommen des Menschensohnes und seinem Heilswirken, besonders aber durch seinen Kreuzestod und seine Auferstehung ist unsere Zeit in die Ewigkeit des dreifaltigen Lebens aufgenommen. Während in der Menschwerdung des Gottessohnes das Ewige in die Geschichte eingetreten ist, wird diese durch Auferstehung und Himmelfahrt in die Ewigkeit aufgenommen: „Durch das Grab hindurch […] ist Geschichte in ihm zur Ewigkeit geworden.“14 Der Auferstandene nimmt „gewissermaßen das innerste Leben der Erde, der Schöpfung, mit, an der er teilgehabt hat“15. Der zum Himmel Gefahrene hat die Zeit fortan für immer in sich, ohne sich vom Gelebten je zu trennen. Weil der auferstandene Gottessohn die Zeit in seine Verherrlichung beim Vater mitgenommen hat, gibt es für den, der glaubt, kein quantitatives, chronologisches Zeitverständnis mehr. Seit der Menschwerdung und Auferstehung des Gottessohns ist alles im Leben des Menschen „ewigkeitsfähig, weil immer schon ewigkeitshaltig“16.
Die Geschehnisse unmittelbar nach der Auferstehung sagen nicht nur etwas über den zu seinem Vater heimgekehrten Herrn im Himmel, sondern auch über sein neues Verhältnis zur Welt und zur Zeit. Die vierzig Tage nach Ostern mit ihren Ereignissen bedeuten die abschließende Vergöttlichung seiner Sendung und enthalten ihr Hinüber in die Ewigkeit des Vaters. Ohne die Himmelfahrt wäre das Leben Jesu den historischen Gesetzmäßigkeiten unterworfen, als gäbe es für immer wirklich ein „heiliges Land“ mit heiligen Stätten, und auch die Zeitgenossen Jesu blieben gegenüber den Späteren bevorzugt. Doch in der Feier des Herrenjahres und der Eucharistie wie auch bei der Verkündigung und Auslegung der Heiligen Schrift kommt das zum Himmel gefahrene Wort erneut zu den Menschen und ist unter ihnen gegenwärtig.17
Der Menschensohn gibt den Lebenszeiten des Menschen, in die er während seines irdischen Daseins selbst eingetreten ist, eine besondere, ja, neue Bedeutung, denn sie werden nicht nur zu einem Ausdruck göttlicher Offenbarung, sondern auch göttlicher Angleichung18: „Wenn Gott Mensch wird, so wird der Mensch als solcher Ausdruck, gültige und authentische Übersetzung des göttlichen Mysteriums. Gewiß braucht der Mensch den übernatürlichen Glauben, um zu fassen, was der souverän freie Gott ihm in einer spontanen Selbstoffenbarung kundtun will. Andererseits aber bleibt dieser göttliche Sinn dem Menschen, der ja gewählt ist, ihn auszudrücken, nicht äußerlich und fremd.“19 Gottes Offenbarung tritt nicht äußerlich in das Leben des Menschen ein, noch bleibt sie eine rein abstrakte Lehre, vielmehr ist sie mit der Menschwerdung des Gottessohnes zum innersten Gesetz menschlicher Existenz überhaupt geworden.
Die Gegenwart des Gottesreiches in der Zeit zum Ausdruck zu bringen, dies ist der Inhalt der christlichen Existenz in der Geschichte. Wie solches auf vollkommene Weise geschieht, zeigt sich im Leben der Heiligen: „Der Auftrag eines jeden Heiligen ist es, ein bestimmtes Anliegen seiner Zeit von der Ewigkeit her, aus dem Wissen um Christus, zu ergreifen und zu bewältigen; indem er das Zeitliche mit Ewigem erfüllt, erhebt er die Zeit und Geschichte zum Ruhm des Herrn; daß die Zeit den Herrn rühme, ist die Sehnsucht der Heiligen.“20 Dadurch, daß der Heilige in der Unmittelbarkeit mit Christus lebt, trägt er wesentlich zur fortschreitenden Wirkmächtigkeit des Evangeliums in der Zeit bei, eine Wirksamkeit, die sich über den Tod des Heiligen hinaus fortsetzt.
Gewiß, die Offenbarung ist mit dem Tod des letzten Apostels abgeschlossen, aber der Heilige Geist wirkt weiterhin, nicht weil sich Gottes Wort weiter entfaltet, sondern „ad directionem actuum humanorum“, wie Thomas von Aquin lehrt21, also um dem Fortschritt im Leben des Christen zu dienen. Aber hier bedarf es einer wichtigen Differenzierung. Das Leben der Kirche ähnelt in keiner Weise dem, wie Israel in der Geschichte seinem Gott begegnet; denn seit dem Kommen Christi kann es nichts mehr geben, was absolut neu ist. Auch wenn am Ende der Zeiten der Schleier, der auf den sichtbaren Zeichen liegt, genommen ist, wird die Wirklichkeit dann keineswegs größer sein als jene, die jetzt schon, wenn auch verborgen, in der Feier der Liturgie gegenwärtig ist. Die himmlische Liturgie ist die gleiche, die von der Kirche hier und jetzt gefeiert wird.
Alles im menschlichen Dasein entscheidet sich, wie Ratzinger betont, an der Frage nach Gott: Ist er ein Gott der Lebenden oder der Toten? Dies gilt auch für die Verkündigung und die Feier der Sakramente: Würde es hier nur um das Vermächtnis eines historischen Jesus gehen, blieben der Gottesdienst und die Messe bloß Ritual und Ausdruck von Gemeinschaft, so daß sich der Glaube auf die Dimensionen von Erlebnis und Gefühl reduzieren ließe. Aber in der Feier der Liturgie verkündet die Kirche die Gegenwart jenes göttlich-dreieinen Mysteriums, das in und mit der Menschwerdung des Gottessohnes in die Geschichte eingetreten ist und sie mit seiner Auferstehung unüberbietbar vollendet hat. 2. Leibhafte Gebärde
Die weiteren geistlichen Implikationen aus dem theologischen Werk Ratzingers ergeben sich als eine Konkretisierung jenes inkarnatorischen Grundanliegens, das er mit Bonaventura teilt. Der Ansatz beim Leib und der konkreten Glaubenspraxis des Alltags erklärt sich bei Joseph Ratzinger aus seinen frühen Studien zum Werk Bonaventuras. Wie es von der Seele heißt: „anima vult, totum mundum describi in se“, so ist gleiches auch vom Leib zu sagen. Ja, es gilt noch mehr: Der Leib ist das Ende der Wege Gottes, und ohne den Leib gibt es keinen Glauben! Deshalb sollen die Gläubigen, wie Bonaventura darlegt, „durch ihr Tun sichtbar werden lassen, daß sie durch den Glauben zur Erkenntnis der Wahrheit gelangt sind“22. Solches Erkennen im Tun übersteigt alles bloße Begreifen, denn es geht um ein Ergriffensein, das einer Ekstase gleichkommt: „Im Begreifen ergreift der Erkennende das Erkannte, in der Ekstase aber ergreift das Erkannte den Erkennenden.“23 Ekstase wird für Bonaventura zur Urform christlichen Lebens, sie ist die einzig mitteilbare Gestalt des Glaubens. In dem Augenblick, da der Mensch in der Kraft seiner Sehnsucht unmittelbar in die Geschichte Jesu eintritt und sich vom Vor-Bild (exemplar) Christi prägen läßt, wird sein Leben aus dem bloßen Gedanken erlöst in das Tun. Der Mensch wird selbst zum Bildstoff der kreatürlichen Menschwerdung. Dann wird sich das Leben Jesu im Leben des Menschen „eindrücken“, so daß der Mensch zum „Ausdruck“ des Herrn wird, ja, zum lebendigen Abbild. So wird der Mensch im Glauben an den Menschensohn befähigt, in seinem Leben dem Herrn „leibhaft“ zu entsprechen und alles Erdhafte in die Beziehung zu Christus hineinzunehmen.
Noch in einer anderen Hinsicht ergibt sich aus der Schöpfungstheologie ein wichtiger Hinweis für die konkrete Glaubenspraxis. Meist reduzierte sich in den vergangenen Jahrhunderten die Aussage über die Schöpfung darauf, daß diese in Gott ihre Ursache hat. Das ist aber ein Minimum an objektivem Gehalt und subjektivem Vollzug. Ferner kam es mit der Neuzeit zu einem grundlegenden Wandel im Weltverständnis. Nun sieht sich der Mensch, als res cogitans gedacht, der Welt als der res extensa entgegengestellt; er bedient sich der Welt, indem er sich seine eigene Welt schafft. Dieser Prozeß ist selbstverständlich nicht rein negativ zu beurteilen, doch er führt zu einem eindimensionalen Umgang mit der Welt, die zunehmend ihre theophane Struktur verliert. Ein Vorgang von theologischer Tragweite: Schon Schelling24 und Baader25 wiesen darauf hin, daß in dem Augenblick, da der Glaube die Welt verliert, er auch Gott verliert.
Der christliche Gott offenbart sich nicht als eine Weltseele, die in der Schöpfung ihren sichtbaren Ausdruck findet. Wesensausdruck des unendlichen Gottes ist allein der göttliche Logos. Obwohl die Welt nur ein kontingentes und endliches Symbol bleibt, ist die Schöpfung – bei aller Unähnlichkeit – doch in allem Selbstausdruck Gottes. Dies bezeugt die Heilige Schrift auf vielfältige Weise. Nach Psalm 19 bergen Himmel und Erde, Tag und Nacht ein lautloses Wort Gottes in sich (vgl. Pss 29.50.97). Denn die Schöpfung „ist erfüllt von der Huld des Herrn“ (Ps 33, 5), was „die Wesensqualifikation der Schöpfung“ anzeigt.26 In der Anklage des Hiob verleiht Gott seiner Schöpfung das Wort, um ihn eines Besseren zu belehren. Nicht anders das neutestamentliche Zeugnis: Jesus macht die Schöpfung „zur Predigerin Gottes“, schon in den endlichen Gleichnissen der Schöpfung zeigt sich die endgültige Verheißung des Reiches.
Die Gleichnisse Jesu, wie sie in den Evangelien überliefert sind, müssen in ihrer eigentlichen Dimension gesehen und gedeutet werden. Denn sie sind mehr als eine Erzählform und literarische Gattung, sie stellen selber so etwas wie eine Theologie dar, nämlich eine Theologie der Schöpfung: „Nur weil die Schöpfung Gleichnis ist, kann sie Wort des Gleichnisses werden.“27 So sprechen die Gleichnisse in Bildern, die authentischer Ausdruck der Wirklichkeit sind, die nie aufgehört hat, Schöpfung Gottes zu sein.
Aber es ist noch mehr zu sagen. Denn die Gleichnisse sind nicht nur Bilder aus der Schöpfung, sie zeigen auch deren Daseinsgrund an. Die Schöpfung ist ein großes und unauslotbares Geheimnis, weil Gott in sie eintreten und in ihr „Fleisch“ annehmen kann. So wird in der Menschwerdung der Gottessohn selbst zu einem Gleichnis, das sich schließlich aber überbietet in seinem eigentlichen Sinn, nämlich in der Auferstehung: Gott tritt wirklich in die menschliche Realität ein, bis in das Leid und den Tod, doch er überbietet alles mit sich selber im Geheimnis von Ostern. Es gilt sogar: Gott kann in seine Schöpfung eintreten und sich im Menschen inkarnieren, weil das Fleisch immer schon Ausdrucksgestalt des Geistes ist, doch „andererseits gibt damit die Inkarnation des Sohnes dem Menschen und der sichtbaren Welt erst endgültig ihre eigentliche Bedeutung“28.
Was Christus in seinen Gleichnissen zum Ausdruck bringt, ist also mehr als nur eine schöne Erzählung, sie enthalten vielmehr eine Theologie der Schöpfung und des menschlichen Daseins. Im Gleichnis zeigt sich die Tiefendimension aller Schöpfungswirklichkeit, die für den Menschen zur Aufforderung wird, Gott in allen Dingen zu suchen und die „vestigia Dei“ auszubuchstabieren: „Das Gleichnis tritt nicht von außen her an die Welterfahrung heran, sondern es gibt ihr erst ihre eigentliche Tiefe, es sagt erst, was in den Dingen selbst steckt. Die Gleichnisse sind somit eine präzise Erfahrung der Wirklichkeit, ihre authentische Erkenntnis.29
Eine solche Theologie der Schöpfung, wie sie in den Gleichnissen Jesu enthalten ist, wird für das Verständnis der sakramentalen Vollzüge von grundlegender Bedeutung. Die Sakramente „inkarnieren“ gleichsam das christliche Weltbild, nämlich die Wirklichkeit als Schöpfung. In diesem Verständnis der Feier der Sakramente liegt die christliche Antwort auf die Neuzeit, es bedarf nämlich einer sakramentalen Wiedergewinnung der Wahrheitsidee. Der Mensch muß aus der Sekundärwelt des Gemachten zurückkehren auf die Spur der Schöpfung, nur so kann er wieder wahrheitsfähig werden. Noch ehe wir Sinn machen, ist er schon da, so daß all unser Erkennen ein „Nachdenken“ ist.
Zu solchem Nachdenken sieht sich der Mensch aufgefordert in den Gleichnissen der Evangelien: „Weil der Leib Sichtbarkeit der Person, die Person aber Bild Gottes ist, daher ist der Leib in seinem ganzen Beziehungsbereich zugleich der Raum, in dem sich das Göttliche abbildet, aussagbar und anschaubar wird.“30 Die Heilige Schrift schafft in den Gleichnissen nicht bloß „Bilder“ von Gott, „sondern sie kann die leiblichen Dinge als Bilder gebrauchen, Gott in Gleichnissen erzählen, weil dies alles wahrhaft Bilder sind. Die Schrift verfremdet also mit solcher Gleichnisrede nicht die leibliche Welt, sondern benennt darin ihr Eigentliches, den Kern dessen, was sie ist. Indem sie sie als Vorrat an Bildern für die Geschichte Gottes mit dem Menschen deutet, zeigt sie ihr wahres Wesen auf und macht Gott in dem sichtbar, worin er sich wirklich ausdrückt. In diesem Kontext versteht die Bibel auch die lnkarnation.“31 Die Aufnahme der menschlichen Welt, der im Leib sich ausdrückenden menschlichen Person in das biblische Wort, ihre Umwandlung in Gleichnis und Bild Gottes durch die biblische Verkündigung, ist gleichsam schon eine vorweggenommene Inkarnation: Gott drückt sich selbst in der Schöpfung aus und kann in ihr erkannt werden: „Ist doch, was sich von Gott erkennen läßt, offenbar. Gott selbst hat es kundgetan. Denn sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und Göttlichkeit sind seit der Erschaffung der Welt an seinen Werken zu erkennen“ (Röm 1,19f.). In der Inkarnation des Logos vollendet sich, was in der biblischen Geschichte von Anfang an schon unterwegs ist. Das Wort zieht darin schon fortwährend gleichsam das Fleisch an sich, macht es zu seinem Fleisch, zum Lebensraum seiner selbst. Einerseits kann Inkarnation nur geschehen, weil das Fleisch immer schon Ausdrucksgestalt des Geistes und so möglicher Wohnort des Wortes ist; andererseits gibt damit die Inkarnation des Sohnes dem Menschen und der sichtbaren Welt erst endgültig ihre eigentliche Bedeutung.“32
Bonaventura bringt es in eine geradezu hymnische Sprache: „Wer vom Glanz der geschaffenen Dinge nicht erleuchtet wird, ist blind; wer durch dieses laute Rufen der Natur nicht erweckt wird, ist taub; wer von diesen Wundern der Natur beeindruckt, Gott nicht lobt, ist stumm; wer durch diese Signale der Welt nicht auf den Urheber hingewiesen wird, ist dumm. Öffne darum deine Augen, wende dein geistiges Ohr ihnen zu, löse deine Zunge und öffne dein Herz, damit du in allen Kreaturen deinen Gott entdeckst, hörst, lobst, liebst […], damit nicht der ganze Erdkreis sich anklagend gegen dich erhebe!“33 Eine solche theologische Sprache von der Schöpfung haben wir heute teils verloren, aber in den geistlichen Vollzügen des Glaubens wiederzugewinnen.
Die der Schöpfung ureigene Sprache hat nichts gemein mit dem, was sich heute als Unendlichkeitsstimmung gebärdet: Diese läßt den Menschen lieber in einem namenlosen All verschwinden, als vor das Antlitz des Menschensohnes treten, dessen Augen wie Feuerflammen sind (vgl. Apk 1,14). Ein stark psychologisch verfaßter Pietismus des Lieblichen räumt alle Komplexitäten beiseite und hebt alle sprachlichen Unebenheiten weit weg von der Sprache des Markus oder des Jesaja. Gottes Wort, scharf wie ein Schwert, scheint sich heute zu verlieren im weichen Ton der Belanglosigkeit und sucht zu leicht sein Maß an Rilkes Stundenbuch oder de Saint-Exupérys Kleinem Prinzen. Der Psychologe Albert Görres, den Joseph Ratzinger zitiert, spricht von einer neuen „Hinduisierung“ des Christentums, „in der es nicht mehr auf Glaubenssätze ankommt, sondern auf das Berührtwerden von einer spirituellen Atmosphäre“. Doch: „Es gibt kein Christentum ohne ‚Prägnanztendenz‘. Es gibt keine Lehre Jesu ohne Knochen, ohne dogmatisches Prinzip. Jesus wollte keine inhaltlose Ergriffenheit bewirken“34. Der sanfte Slang meditativ verschwebender Gläubigkeit wird Gott keineswegs gerecht, zumal dessen Sprache kaum die gewaltige Wahrheit der geschöpflichen Welt auszusagen vermag.
Ein kuscheliger Seelengott, der mit viel psychologischer Stilisierung ins Wort gefaßt wird, wird nicht dem Aufwand gerecht, der sich in den Kosten der Entwicklung an Molekülen, Samen, Arten und Gestalten zeigt. Auch der Mensch im Kosmos ist mehr als die platte Zärtlichkeit eines „Gott liebt dich, wie du bist“, heißt es doch: „Von Jahr zu Jahr säst du die Menschen aus; sie gleichen dem sprossenden Gras. Am Morgen grünt es und blüht, am Abend wird es geschnitten und welkt“ (Ps 90,5f,). „Weder das Heil, das Gott in Jesus Christus für die Menschen will, noch das Reich, das aus diesem Heilswillen und seiner tätigen Aufnahme unter uns wächst, dürfen wir – anthropo- oder auch geo(gäa?)zentrisch – auf die horizontale Natur-Dimension verkürzen.“35
Wo der Mensch auf die Sprache der Schöpfung nicht achtet und seinen Leib asketisch oder libertinistisch verhöhnt, verachtet er sich selbst. Ratzinger bemerkt: „Schöpfungstheologische Askese wie Libertinismus führen mit zwanghafter Notwendigkeit zum Haß des Menschen auf dieses sein Leben, auf sich selbst, auf die Wirklichkeit des Ganzen.“36 3. Deus caritas est
Die geistlichen Implikationen der eucharistischen Ekklesiologie konkretisieren sich in einem Leben aus der Liebe. Dies zeigt die Enzyklika „Deus caritas est“ vom 25. Dezember 2005 37. Sie umfaßt 78 Seiten und hat einen ersten philosophisch-theologischen Teil sowie einen zweiten mit konkreten Folgerungen aus dem Gebot der Nächstenliebe. Auch wenn die Liebe viele Dimensionen hat, bildet sie „eine einzige Wirklichkeit“, denn zwischen Gottes- und Nächstenliebe, zwischen schenkender und begehrender Liebe besteht eine innere Einheit.
Die Enzyklika beginnt mit den Worten: „‚Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm‘ (1 Joh 4,16). In diesen Worten aus dem Ersten Johannesbrief ist die Mitte des christlichen Glaubens, das christliche Gottesbild und auch das daraus folgende Bild des Menschen und seines Weges in einzigartiger Klarheit ausgesprochen. Außerdem gibt uns Johannes in demselben Vers auch sozusagen eine Formel der christlichen Existenz: ‚Wir haben die Liebe erkannt, die Gott zu uns hat, und ihr geglaubt‘ (vgl. 4,16). Wir haben der Liebe geglaubt: So kann der Christ den Grundentscheid seines Lebens ausdrücken. Am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluß oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. In seinem Evangelium hatte Johannes dieses Ereignis mit den folgenden Worten ausgedrückt: ‚So sehr hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, […] das ewige Leben hat‘ (3,16).“
Die Liebe ist nicht bloß eine Verhaltensweise Gottes, sondern sein tiefstes Geheimnis.38 Gott schenkt nicht nur Liebe, alles in ihm ist Liebe. Die Liebe ist nicht etwas am Menschen, sie ist das tiefste göttliche Mysterium: Gott liebt nicht nur, er ist die Liebe.
Eine Grundaussage im christlichen Verständnis der Liebe besteht darin, daß die Liebe mehr ist als ein Gefühl, da sie vor allem „vernünftig“ sein will. Mit dieser Aussage wird das Hauptthema des theologischen Werkes Joseph Ratzingers angesprochen: Glaube und Vernunft befruchten und stärken sich gegenseitig. So heißt es in der Enzyklika „Deus caritas est“: „Der Glaube hat gewiß sein eigenes Wesen als Begegnung mit dem lebendigen Gott – eine Begegnung, die uns neue Horizonte weit über den eigenen Bereich der Vernunft hinaus öffnet. Aber er ist zugleich auch eine reinigende Kraft für die Vernunft selbst. Er befreit sie von der Perspektive Gottes her von ihren Verblendungen und hilft ihr deshalb, besser sie selbst zu sein. Er ermöglicht der Vernunft, ihr eigenes Werk besser zu tun und das ihr Eigene besser zu sehen“ (Art. 28).
Der Ansatz bei der Vernunft läßt das Wesen der christlichen Liebe tiefer erfassen, wie es sich im Leben Christi selbst zeigt und auf unüberbietbare Weise offenkundig wird. Christus ist der Maßstab des wahren Humanismus, in ihm sind Wahrheit und Liebe eins. So führt die Enzyklika aus: „Die Liebe ist nun dadurch, daß Gott uns zuerst geliebt hat (vgl. 1 Joh 4,10), nicht mehr nur ein ‚Gebot‘, sondern Antwort auf das Geschenk des Geliebtseins, mit dem Gott uns entgegengeht.“ Unter Artikel 17 lesen wir weiterhin: „Er hat uns zuerst geliebt und liebt uns zuerst; deswegen können auch wir mit Liebe antworten. Gott schreibt uns nicht ein Gefühl vor, das wir nicht herbeirufen können. Er liebt uns, läßt uns seine Liebe sehen und spüren, und aus diesem ‚Zuerst‘ Gottes kann als Antwort auch in uns die Liebe aufkeimen.“
Am Beginn des ersten Teils der Enzyklika wird die Problemstellung kurz skizziert: „Das Wort ‚Liebe‘ ist heute zu einem der meist gebrauchten und auch mißbrauchten Wörter geworden, mit dem wir völlig verschiedene Bedeutungen verbinden“ (Art. 2). Doch nicht das Denken und Machen sind die Bausteine dieser Welt, sondern die Liebe. Jesus offenbart auf vollkommene Weise das Geheimnis der Liebe, nämlich in seiner Kenose. Er ist nicht in sich stehend geblieben (Hypostase), sondern entäußerte sich und wurde Mensch.
Eigens werden die beiden Grunddimensionen der Liebe hervorgehoben, nämlich der „Eros als Darstellung der ‚weltlichen‘ Liebe und Agape als Audruck für die im Glauben gründende und von ihm geformte Liebe. […] In Wirklichkeit lassen sich Eros und Agape – aufsteigende und absteigende Liebe – niemals voneinander trennen. […] Im letzten ist ‚Liebe‘ eine einzige Wirklichkeit, aber sie hat verschiedene Dimensionen“ (Art. 7). Das Neue in der biblischen Auffassung der Liebe „zeigt sich vor allem in zwei Punkten, die verdienen, hervorgehoben zu werden: im Gottesbild und im Menschenbild“ (Art. 8). Die Neuheit des biblischen Gottesbildes besteht darin: „Es gibt eine Vereinigung des Menschen mit Gott – der Urtraum des Menschen -, aber diese Vereinigung ist nicht Verschmelzen, Untergehen im namenlosen Ozean des Göttlichen, sondern ist Einheit, die Liebe schafft, in der beide – Gott und der Mensch – sie selbst bleiben und doch ganz eins werden“ (Art. 10).
Auch die Neuheit des biblischen Menschenbildes zeigt sich im Schöpfungsbericht: Der Mensch wird „nur im Miteinander von Mann und Frau ganz“ (Art. 11), indem sie „ein Fleisch“ miteinander werden: „Dem monotheistischen Gottesbild entspricht die monogame Ehe. Die auf einer ausschließlichen und endgültigen Liebe beruhende Ehe wird zur Darstellung des Verhältnisses Gottes zu seinem Volk und umgekehrt: die Art, wie Gott liebt, wird zum Maßstab menschlicher Liebe. Diese feste Verknüpfung von Eros und Ehe in der Bibel findet kaum Parallelen in der außerbiblischen Literatur“ (Art. 11).
Gewiß, das Sakrament der Ehe deutet Paulus ekklesiologisch. Wird die Ehe nur im Zusammenhang mit jenen gesehen, die da heiraten, also nicht in ihrem Bezug auf die ganze Kirche und damit auf die Welt, ist ihr wahrer sakramentaler Charakter nicht begriffen, nämlich jenes große „Geheimnis“, auf das Paulus die Worte anwendet: „Aber ich spreche im Hinblick auf Christus und die Kirche.“ Doch das wahre Thema, der Inhalt und der eigentliche Gegenstand dieses Sakraments ist nicht die „Familie“ bzw. die Fortpflanzung sondern die Liebe, wie sie in der Schöpfungsordnung begründet ist.39
Die Offenbarung in Christus geht über die Schöpfungswirklichkeit nicht hinaus, sie erschließt diese in einem neuen, d.h. tieferen Sinn für die Befreiung und Erlösung des Menschen.40 Beide Realitäten göttlichen Handelns gehören zu der einen Heilsordnung Gottes: Schöpfungsplan und Heilsplan stellen keine zwei eigenständigen Wirklichkeiten dar. Die Sakramentalität ist keine zur Ehe hinzutretende Wirklichkeit, sie fügt der Gabe des Schöpfers nichts hinzu, sondern deckt deren tieferen Heilssinn auf, nämlich jene geschenkte Möglichkeit ehelicher Begegnung, in der die Eheleute das von Christus verheißene Heil empfangen und aus ihm leben.41 Das Neue im christlichen Eheverständnis liegt in der unaufkündbaren Beziehung der Brautleute zu Christus und seiner Kirche.
Im Neuen Testament wird die Schöpfungsordnung der Ehe in ihrem vollen Sinn erkennbar. So wird das Bild vom Ehebund, mit dem Gott seine Treue zum Volk zusichert (Jes 54; Jer 3,6ff.; Ez 16; Hos 2), durch das Bild vom Hochzeitsmahl (Mt 9,15; 25,1ff.; Mk 2,19f.; Lk 5,34f.; Joh 3,29) ergänzt: „Das Eheverhältnis wird hier gleichsam zur Grammatik, mit deren Hilfe die Offenbarung das Verhältnis Gottes zu uns buchstabiert.“42 Was in der Schöpfungsordnung angelegt war, wird in der Ehe offenbar. Die göttliche Treue ist demnach kein Abbild der menschlichen Treue, vielmehr erhält die menschliche Treue Anteil an der Treue Gottes.43
Gott begegnet uns in der Liebe zum Mitmenschen. Dies gilt in besonderer Weise für die Ehe, sie ist Ort der Gottes- und Christusbegegnung. Und daß Gott in der Kirche die vielen zu einem Leib verbindet, findet seine schöpfungsgemäße Erfüllung in der Ehe, wo sich zwei Menschen aus Liebe zu einem Leib vereinigen. So wird die Ehe zum vergegenwärtigenden Zeichen der Treue und Liebe Gottes in Christus und zu seiner Kirche (DH 1327).
Über die Einheit von Schöpfungs- und Heilsordnung in der Ehe schreibt Joseph Ratzinger: „Als Schöpfungsordnung ist sie Bundesordnung, und als Bundesordnung vollzieht sie die Schöpfungsordnung. Richtiger und genauer müßten wir sagen: Die Realität des Bundes ermöglicht erst die wahrhaft der Schöpfung gemäße Ordnung des ‚Naturphänomens‘, das als bloßes Naturphänomen überhaupt nicht bestehen kann, sondern immer nur als geschichtlich Geordnetes und daher gewöhnlich auch geschichtlich Überfremdetes. Für denjenigen, der sich im Glauben in die Bundesgeschichte stellt, empfängt es logischerweise seine Ordnung nicht mehr von irgendeiner Geschichte her, sondern eben von der Bundesgeschichte, die allein den Menschen in seine Ursprünge zurückrufen und aus seinen Überfremdungen befreien kann. Das aber heißt: Sakrament ist nicht etwas über, neben oder an der Ehe, sondern gerade die Ehe selbst, und als solche ist sie für den, der sie im Glauben lebt, das Sakrament. Je mehr es ihm gelingt, die Ehe aus dem Glauben zu leben und zu gestalten, desto mehr ist sie ‚Sakrament‘.“44
Immer wieder kommt die Enzyklika auf die Liebe zwischen Mann und Frau zu sprechen, „in der Leib und Seele untrennbar zusammenspielen und dem Menschen eine Verheißung des Glücks aufgeht, die unwiderstehlich erscheint, als der Urtypus von Liebe schlechthin, neben dem auf den ersten Blick alle anderen Arten von Liebe verblassen“ (Art. 2).
Das Urmodell menschlicher Liebe findet sich nach Aussage der Enzyklika jedoch nicht in der ehelichen Liebe von Mann und Frau, sondern in der Liebe Gottes selbst, wie sie sich in Christus geoffenbart hat. Die Enzyklika legt dies damit dar, daß sie die wahre Liebe Gottes offenbar geworden sieht in der geöffneten Seite des Gekreuzigten, also an der Stelle, wo Eva aus Adam hervorging. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heißt es im Leitartikel zur der neu erschienenen Enzyklika des Papstes resümierend: „Niemals zuvor hat ein Papst so einfühlsam und poetisch, zugleich theologisch von umfassender Bildung über die menschliche Liebe, vom ‚Versinken in der Trunkenheit des Glücks‘, geschrieben wie Benedikt.“45
Das Christentum wird in der Enzyklika als keine Sonderwelt neben dem Staat angesprochen, vielmehr weiß sich der Christ in allem als „Salz der Erde“ und darin in die Pflicht genommen für seinen Einsatz in der Welt. Christliches Leben im Glauben ist in der Enzyklika nicht auf Frömmigkeit, geistliche Verpflichtungen und Gebote enggeführt, vielmehr werden die sozialen Verpflichtungen des Glaubens hervorgehoben. Hier erweist sich der Ansatz einer Theologie der Liebe als äußerst fruchtbar: Glaube beschränkt sich nicht allein auf die Übernahme einer „fides quae“, er hat sich im Einsatz und in der Hingabe zu bewähren.
Darin zeigt sich ein Grundgesetz des christlichen Glaubens und seiner Heilswirklichkeit: Der Mensch wird gerettet, indem er mitwirkt, andere zu retten. Erlöst, gerettet und geheiligt wird der Mensch für die anderen und insofern auch durch die anderen.
Die „Existenzrichtung Jesu, sein eigentliches Wesen“, sieht Joseph Ratzinger in dem Wort „für“. Die Rettung des Menschen besteht darin, daß er wird wie er, aber dann muß er auch „für“ die anderen leben und sich hingeben. Christsein ist das beständige Pascha des Übergangs aus dem Sein für sich in das Sein füreinander.
Glaube ist mehr als die Übernahme eine Lehre und das Einhalten bestimmter Gebote, wie auch die Heilige Schrift noch nicht das eigentlich Neue des christlichen Glaubens ausmacht: Das Neue ist nicht eine Lehre, sondern die Person Jesus Christus. In ihm offenbart sich Gott als die Liebe und so als das Ziel menschlichen Strebens und Suchens. Die Enzyklika betont die Priorität der Liebe als Mitte des christlichen Glaubens, weil so deutlich wird, daß es im christlichen Glauben um keine Werkfrömmigkeit bzw. Werkgerechtigkeit geht. Es handelt sich vielmehr um die „fides caritate formata“, in der die Werke die „Frucht“ des Glaubens selber sind. Mit diesem Ansatz wehrt sich der Heilige Vater gewiß gegen ein Verständnis des Glaubens, wie es zuweilen der Befreiungstheologie zugesprochen wird.
Ferner geht es Papst Benedikt in seiner Enzyklika darum, Askese weniger in ihrer abtötenden Funktion als vielmehr als leibhafte und ganzheitliche Einübung in den Glauben darzulegen: Nicht die Askese macht den Christen, sondern die Liebe. In diesem Sinn sind die Evangelischen Räte in ihrer theologischen und nicht so sehr rein asketischen Funktion hervorzuheben: Die restlose Hingabe mit dem Leib ist ein Ausdruck des neuen, radikalen Gottesverhältnisses: „Der Glaube ist keine Theorie, die man akzeptieren oder zurückstellen kann. Er ist etwas sehr Konkretes: Er ist das Kriterium, das über unseren Lebensstil entscheidet.“46
Der Christ hat seinen konkreten Liebesdienst zu leisten in der „Solidarität aller Völker“ und kann ihn nicht nur dem Staat überlassen (Art. 30). Aufgabe aller Christen ist es, menschenwürdiges Leben für alle möglich zu machen und zu sichern. In diesem Sinn ist das, was die Aktionen von Misereor und Adveniat als Hilfe der deutschen Kirche für einige Länder leisten, als eine weltweite Organisation zu konzipieren: Die Kirche muß als Gemeinschaft im Glauben die Liebe üben. Diakonie ist keineswegs bloß das Werk von Einzelnen bzw. von Hilfswerken und Institutionen, es bedarf einer gemeinschaftlichen Diakonie. Insofern vertreten die Hilfsaktionen Misereor und Adveniat nur die eine Seite der Kirche; ihr Anliegen müßte zu einer Strukturaufgabe der Kirche werden: Kirche ist Diakonie – und hat nicht nur Diakonie auszuüben. Dies entfaltet Papst Benedikt an anderer Stelle unter Bezug auf 1 Kor 13,1-3: „Ohne die caritas ist alles übrige, Glaube, Werke, nichts, schlechthin nichtig. Und so treffen sich hier Paulus und Jakobus, denn mit dem Verweis auf den Glauben, der in der Liebe wirkt, grenzt der Apostel den rettenden Glauben, den pneumatisch inspirierten Glauben ab von dem Glauben, der auch den Dämonen eignet, aber nicht retten kann (Jak 2,19). Ohne Liebe, so Augustinus, kann der Glaube zwar ’sein, aber nicht retten‘ – esse, non prodesse, heißt es in dem unnachahmbaren Latein des Bischofs von Hippo.“47 „In der „Orthopraxie“, also in der tätigen Liebe, bestätigt sich der „wahre Glaube“.
Die Donatisten haben, wie Augustinus bemerkt, die gleichen Sakramente wie die Kirche, aber die Differenz liegt darin, daß sie die Liebe gebrochen haben und ihre Idee von Vollkommenheit über die Einheit stellten: „Sie haben alles behalten, was die katholische Kirche ausmacht – nur die Liebe haben sie mit der Einheit aufgegeben. Und darum ist alles andere leer.“48
Kirche ist caritas: „Als Geistgeschöpf also ist die Kirche die ‚Gabe‘ Gottes in dieser Welt, und diese ‚Gabe‘ ist die Liebe. Aber diese dogmatische These hat doch für ihn zugleich einen ganz konkreten Charakter: Christsein kann man nicht in der Sekte, in der Absonderung von den anderen aufbauen. Dann fehlte nämlich genau die Seele des Ganzen, selbst wenn man alle einzelnen Teile hätte. Zum Christsein gehört gerade das Annehmen der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden, die Demut (humilitas) der Liebe (caritas), das ‚einander ertragen‘ – denn sonst fehlt eben der Heilige Geist, der das Vereinigen ist. Die dogmatische Aussage ‚Kirche ist Caritas‘ verbleibt also doch nicht einfach im bloß Dogmatisch-Lehrmäßigen, sondern verweist auf den Einheit stiftenden Dynamismus, der sich im Zueinander-halten der Kirche erweist. Insofern ist für Augustinus das Schisma eine pneumatologische Häresie, die im ganz konkreten Existenzvollzug gesetzt wird: ausziehen aus dem Bleiben, das des Geistes ist, aus der Geduld der Caritas – aufkündigen der Liebe im Aufkündigen des Bleibens und damit Absage an den Heiligen Geist, der die Geduld des Bleibens, des Versöhnens ist“49.
Die Konsequenzen dieses Ansatzes, wie ihn Augustinus in „De Trinitate“ entfaltet, sind eindeutig: „Wer willentlich nicht bleibt, der geht von der caritas weg. Daher sein Satz: Wieviel einer die Kirche liebt, soviel hat er den Heiligen Geist. Trinitätstheologie wird direkt zum Maß der Ekklesiologie, die Benennung des Geistes als Liebe zum Schlüssel der christlichen Existenz und zugleich Liebe konkret interpretiert: als kirchliche Geduld.“50
Alle katholischen Ortskirchen müssen sich im Dienst füreinander und aneinander das Wort in ihr Stammbuch schreiben lassen: „Alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem soviel, wie er nötig hatte“ (Apg 2, 44f.). In der Enzyklika heißt es: „Die in der Gottesliebe verankerte Nächstenliebe ist zunächst ein Auftrag an jeden einzelnen Gläubigen, aber sie ist ebenfalls ein Auftrag an die gesamte kirchliche Gemeinschaft, und dies auf all ihren Ebenen: von der Ortsgemeinde über die Teilkirche bis zur Universalkirche als ganzer. Auch die Kirche als Gemeinschaft muß Liebe üben. Das wiederum bedingt es, daß Liebe auch der Organisation als Voraussetzung für geordnetes gemeinschaftliches Dienen bedarf. Das Bewußtsein dieses Auftrags war in der Kirche von Anfang an konstitutiv. […] Innerhalb der Gemeinschaft der Gläubigen darf es keine Armut derart geben, daß jemandem die für ein menschenwürdiges Leben nötigen Güter versagt bleiben“ (Art. 20).51
In der Enzyklika werden schließlich auch die Sakramente in ihrem „sozialen“ Charakter gesehen, eine Sicht, die bei Luther und Calvin eher vergeblich zu suchen ist und auch in der katholischen Sakramententheologie kaum betont und herausgearbeitet wurde. Eine Grundaussage östlicher Sakramentenlehre lautet: „Jedes ‚mystérion‘ ist immer ein Ereignis in der Kirche, durch die Kirche und für die Kirche. Es schließt jegliche Atomisierung aus, welche den Akt von demjenigen isoliert, der ihn empfängt. Jedes ‚mystérion‘ wirkt sich auf den ganzen Leib der Gläubigen aus.“52 Dies läßt sich am Sakrament der Ehe einsehen. Die Brautleute sind nicht nur je einzeln von einer neuen Wirklichkeit des Glaubens geprägt, ihre Ehe selbst ist ein neues Sein in Christus. Indem die Brautleute in der Trauungsliturgie den Segen erhalten und in einen neuen theologischen Status innerhalb der „ekklesia“ geführt werden, treten sie in eine neue Beziehung zur Eucharistie ein. Mit der Würde des ehelichen Priestertums bekleidet, nehmen sie künftig in einer neuen Funktion an der Eucharistie teil.53
Der Ansatz bei der Liebe und dem zutiefst „sozialen“ Charakter des Glaubens läßt das Sakrament der Eucharistie angemessener verstehen. Das Leben im Glauben ist in der Eucharistie grundgelegt, denn: „Aus dem Gegenüber zu Gott wird durch die Gemeinschaft mit der Hingabe Jesu Gemeinschaft mit seinem Leib und Blut, wird Vereinigung: Die ‚Mystik‘ des Sakraments, die auf dem Abstieg Gottes zu uns beruht, reicht weiter und führt höher, als jede mystische Aufstiegsbegegnung des Menschen reichen könnte“ (Art. 13). Die Eucharistie führt durch die tiefste Vereinigung mit Gott auch in die tiefste Gemeinschaft von und mit allen Menschen: „Die ‚Mystik‘ des Sakraments hat sozialen Charakter. Denn in der Kommunion werde ich mit dem Herrn vereint wie alle anderen Kommunikanten: ‚Ein Brot ist es. Darum sind wir viele ein Leib, denn wir alle haben teil an dem einen Brot‘, sagt der heilige Paulus (1 Kor 10,17). Die Vereinigung mit Christus ist zugleich eine Vereinigung mit allen anderen, denen er sich schenkt. Ich kann Christus nicht allein für mich haben, ich kann ihm zugehören nur in der Gemeinschaft mit allen, die die Seinigen geworden sind oder werden sollen. Die Kommunion zieht mich aus mir heraus zu ihm hin und damit zugleich in die Einheit mit allen Christen. Wir werden ‚ein Leib‘, eine ineinander verschmolzene Existenz. Gottesliebe und Nächstenliebe sind nun wirklich vereint: Der fleischgewordene Gott zieht uns alle an sich. Von da versteht es sich, daß Agape nun auch eine Bezeichnung der Eucharistie wird: In ihr kommt die Agape Gottes leibhaft zu uns, um in uns und durch uns konkret weiterzuwirken. Nur von dieser christologisch‑sakramentalen Grundlage her kann man die Lehre Jesu von der Liebe recht verstehen. Seine Führung von Gesetz und Propheten auf das Doppelgebot der Gottes‑ und der Nächstenliebe hin, die Zentrierung der ganzen gläubigen Existenz von diesem Auftrag her, ist nicht bloße Moral, die dann selbständig neben dem Glauben an Christus und neben seiner Vergegenwärtigung im Sakrament stünde: Glaube, Kult und Ethos greifen ineinander als eine einzige Realität, die in der Begegnung mit Gottes Agape sich bildet. Die übliche Entgegensetzung von Kult und Ethos fällt hier einfach dahin: Im ‚Kult‘ selber, in der eucharistischen Gemeinschaft ist das Geliebtwerden und Weiterlieben enthalten. Eucharistie, die nicht praktisches Liebeshandeln wird, ist in sich selbst fragmentiert, und umgekehrt wird […] das ‚Gebot‘ der Liebe überhaupt nur möglich, weil es nicht bloß Forderung ist: Liebe kann ‚geboten‘ werden, weil sie zuerst geschenkt wird“ (Art. 14), und zwar geschenkt als heilige Eucharistie.
Die Enzyklika will im zweiten Teil ihrer Ausführungen wie eine sakramentale Begründung der Diakonie verstanden werden: „Aus der inneren Begegnung mit Gott heraus, die Willensgemeinschaft geworden ist und bis ins Gefühl hineinreicht, […] lerne ich, diesen anderen nicht mehr bloß mit meinen Augen und Gefühlen anzusehen, sondern aus der Perspektive Jesu Christi heraus. Sein Freund ist mein Freund. Ich sehe durch das Äußere hindurch sein inneres Warten auf einen Gestus der Liebe – auf Zuwendung, die ich nicht nur über die dafür zuständigen Organisationen umleite und vielleicht als politische Notwendigkeit bejahe. Ich sehe mit Christus und kann dem anderen mehr geben als die äußerlich notwendigen Dinge: den Blick der Liebe, den er braucht. Hier zeigt sich die notwendige Wechselwirkung zwischen Gottes‑ und Nächstenliebe, von der der Erste Johannesbrief so eindringlich spricht. Wenn die Berührung mit Gott in meinem Leben ganz fehlt, dann kann ich im anderen immer nur den anderen sehen und kann das göttliche Bild in ihm nicht erkennen. Wenn ich aber die Zuwendung zum Nächsten aus meinem Leben ganz weglasse und nur ‚fromm‘ sein möchte, nur meine ‚religiösen Pflichten‘ tun, dann verdorrt auch die Gottesbeziehung. Dann ist sie nur noch ‚korrekt‘, aber ohne Liebe. Nur meine Bereitschaft, auf den Nächsten zuzugehen, ihm Liebe zu erweisen, macht mich auch fühlsam Gott gegenüber. Nur der Dienst am Nächsten öffnet mir die Augen dafür, was Gott für mich tut und wie er mich liebt. Die Heiligen – denken wir zum Beispiel an die sel. Theresa von Kalkutta – haben ihre Liebesfähigkeit dem Nächsten gegenüber immer neu aus ihrer Begegnung mit dem eucharistischen Herrn geschöpft, und umgekehrt hat diese Begegnung ihren Realismus und ihre Tiefe eben von ihrem Dienst an den Nächsten her gewonnen. Gottes‑ und Nächstenliebe sind untrennbar: Es ist nur ein Gebot. Beides aber lebt von der uns zuvorkommenden Liebe Gottes, der uns zuerst geliebt hat. So ist es nicht mehr ‚Gebot‘ von außen her, das uns Unmögliches vorschreibt, sondern geschenkte Erfahrung der Liebe von innen her, die ihrem Wesen nach sich weiter mitteilen muß. Liebe wächst durch Liebe. Sie ist ‚göttlich‘, weil sie von Gott kommt und uns mit Gott eint, uns in diesem Einungsprozeß zu einem Wir macht, das unsere Trennungen überwindet und uns eins werden läßt, so daß am Ende ‚Gott alles in allem‘ ist (vgl. 1 Kor 15, 28)“ (Art. 18).
Rückblickend läßt sich aus der Betrachtung der geistlichen Implikationen der eucharistischen Theologie Ratzingers zeigen, wie sie das christliche Leben bestimmt. Die Liturgie reicht bis in die Liturgie des Herzens und des alltäglichen Lebens aus dem Heiligen Geist. Mit dem Kommen des Menschensohnes und seiner Auferstehung steht die Schöpfung unter einem neuen Gesetz, nämlich dem Gesetz der Eucharistie, welches das Gesetz der Liebe ist. Gott selbst ist der Inhalt dieses Gesetzes, denn er ist die Liebe. Wer liebt, ist aus Gott, und der Heilige Geist lebt in ihm, bis der Mensch zu einer „leibhaften Gebärde“ Gottes wird. 4. Schau der Geschichte
Joseph Ratzinger hat sich eingehend mit der eschatologisch-apokalyptischen Deutung der Trinitätslehre des Joachim von Fiore (gest. 1202) beschäftigt und sie mit dem biblischen und genuin christlichen Verständnis konfrontiert.
Als biblisches Zeugnis nimmt er zunächst den Propheten Jeremia. Dieser wurde wegen seiner pessimistischen Botschaft verurteilt und eingekerkert, denn er konnte den amtlichen Optimismus der Militärs, des Adels, der Priester und der offiziellen (Erfolgs-)Propheten (Hananja) nicht teilen, daß nämlich Gott die Stadt und den Tempel schützen werde. Jeremia war Realist genug, um zu erkennen, daß ein militärischer Erfolg der Juden gegen die Babylonier kaum zu erwarten sei. Schließlich erweist sich Jeremia als der wahre Realist (Jer 28,9), der die Sachlage beurteilt, wie sie wirklich ist, ohne sich mit falscher Theologie in eine Scheinwelt zu flüchten. Gott wird nie besiegt, auch in scheinbaren Niederlagen weiß er weiter und einen neuen Bund zu schließen (Jer 31,31-34). Wahrer Realismus im Glauben und scheinbarer Pessimismus in der Beurteilung der Situation müssen sich nicht ausschließen. Gott kann auf krummen Zeilen gerade schreiben, zumal Erfolg kein Attribut Gottes ist.
Die Geheime Offenbarung enthüllt die Geschichtsvision eines immerwährenden Fortschritts als eine Täuschung, selbst wenn der Mensch immer wieder meint, göttlich handeln zu können. Gottes Hand erscheint zuweilen als strafend, aber Gott schafft nicht das Leid und will nicht das Elend seiner Kreatur. Er ist kein neidischer Gott. Seine Macht schenkt erst wahre Hoffnung: Die Hand Gottes hindert den Menschen an der letzten Ausführung, die zu Selbstzerstörung führt. Gott läßt die Vernichtung seines Geschöpfes nicht zu. Es offenbart sich so der Sinn aller in der Apokalypse geschilderten Eingriffe Gottes: „Was sich da als göttliche Strafe darstellt, ist nicht eine positivistisch von außen verhängte Geißel, sondern das Sichtbarwerden der inneren Gesetzlichkeit eines menschlichen Handelns, das sich der Wahrheit entgegenstellt und damit zum Nichts – zum Tod – hintendiert. Die ‚Hand Gottes‘, die sich im inneren Widerstand des Seins gegen seine eigene Zerstörung offenbart, hindert den Marsch zum Nichts, sie trägt so das verirrte Schaf zur Weide des Seins, der Liebe zurück. Auch wenn das Herausgenommenwerden aus dem selbstgesuchten Dornengestrüpp und das Zurückgetragenwerden schmerzt, ist es doch der Akt unserer Erlösung, das Geschehen, das uns Hoffnung gibt. Und wer könnte nicht auch heute die Hand Gottes sehen, die den Menschen am äußersten Rand seiner Zerstörungswut und seiner Perversionen erfaßt und ihn hindert, weiterzugehen?“54
Gericht bedeutet auch, daß Gott sich der Frage nach dem Sinn von Schöpfung, Leben und Leid stellt. Hans Urs von Balthasar drückt das so aus: Gott muß gleichsam sich selbst „verteidigen“: „Er hat das einmal getan, als der Auferstandene seine Wundmale gezeigt hat. […] Gott selber muß seine Theodizee erfinden. Er muß sie bereits erfunden haben, als er die Menschen mit Freiheit ausstattete (und deshalb mit der Versuchung), nein zu ihm, zu seinem Gebot zu sagen.“55 Der Herr wird im Gericht, angesichts unserer Fragen, seine Wunden zeigen, und wir werden verstehen.
Auch hier wieder das Gegenüber von scheinbarem „Pessimismus“ und radikaler Hoffnung, wie wir es bei Jeremia finden. Die göttlichen Strafgerichte und Leiden, die über die Menschen kommen, dienen nicht ihrer Zerstörung, sondern der Rettung. Der Mensch ist nicht der einzige Akteur der Geschichte, und darum hat der Tod nicht das letzte Wort.
Diese Verheißung zeigt sich auch in den Seligpreisungen der Bergpredigt. Zwar ist die Proportion zwischen Gegenwart und Zukunft in den einzelnen Seligpreisungen verschieden, aber sie sind alle von derselben Hoffnung getragen: Das prophetische Paradox wird nun zum Lebensmodell christlicher Existenz, wie es erst Paulus ins Wort bringt: „Wir werden verkannt und sind doch anerkannt; wir sind wie Sterbende und siehe: Wir leben; wir werden gezüchtigt und doch nicht getötet; uns wird Leid zugefügt, und doch sind wir jederzeit fröhlich; wir sind arm und machen doch viele reich; wir haben nichts und haben doch alles“ (2 Kor 6,9f.).56
Eine zentrale Erfahrung auf dem Weg zur letzten Vollendung ist die von Schuld und Sünde: „Vergebung ist Teilnahme am Schmerz des Übergangs von der Droge der Sünde zur Wahrheit der Liebe. Sie ist ein Vorausgehen und Mitgehen auf diesem Weg von Tod und Wiedergeburt. Nur ein solches Vorausgehen und Mitgehen kann dem Süchtigen (und Sünde ist immer ‚Droge‘, Lüge des falschen Glücks) schenken, sich durch den dunklen Gang der Schmerzen führen zu lassen. […] Nur die Liebe gibt die Kraft zum Verzeihen, d.h. zum Mitgehen mit dem anderen auf der Straße des verwandelnden Leidens. Nur sie macht es möglich, mit dem anderen und für ihn den Tod der Lüge anzunehmen und zu ertragen.“57
Der Pelagianismus der Frommen besteht darin, daß sie keine Vergebung und eigentlich überhaupt keine Gabe von Gott haben wollen: „Sie wollen selbst in Ordnung sein – nicht Vergebung, sondern gerechten Lohn. Sie möchten nicht Hoffnung, sondern Sicherheit. Mit einem harten Rigorismus religiöser Übungen, mit Gebeten und Aktionen wollen sie sich ein Recht auf die Seligkeit schaffen. Ihnen fehlt die für jede Liebe wesentliche Demut – die Demut, über unser Verdienen und Leisten hinaus Geschenktes zu empfangen. Die Verleugnung der Hoffnung zugunsten der Sicherheit, vor der wir hier stehen, beruht auf der Unfähigkeit, die Spannung auf das Kommende hin zu ertragen und sich der Güte Gottes zu überlassen. So ist solcher Pelagianismus eine Apostasie von der Liebe und von der Hoffnung, im tiefsten damit aber auch vom Glauben. Das Herz des Menschen wird dabei hart gegen sich selbst, gegen die anderen und letztlich gegen Gott: Der Mensch braucht ja Gottes Gottsein, seine Liebe nicht mehr. Er setzt sich selbst ins Recht, und ein Gott, der da nicht mittut, wird sein Feind. Die Pharisäer des Neuen Testaments sind die immer gültige Darstellung dieser Deformation von Religion. Der Kern dieses Pelagianismus ist eine Religion ohne Liebe, die so zur traurigen Karikatur von Religion entartet. […] Der Pelagianismus der Frommen ist ein Kind der Furcht, einer gelähmten Hoffnung, die die Spannung auf das nicht erzwingbare Geschenk der Liebe nicht aushalten kann. So wird aus Hoffnung Angst, und die wieder gebiert das Streben nach Sicherheit, in der keine Ungewißheit bleiben darf. Nun überwindet nicht die Liebe die Furcht, weil der Selbstsüchtige sich ihrer Art der immer ’nur‘ dialogischen Gewißheit nicht anvertrauen will. Furcht muß bei diesem Ausgangspunkt gebannt werden, unabhängig von dem anderen durch das, was in meiner eigenen Verfügung steht – durch mein eigenes Machen, mein ‚Werk‘. Solches Streben nach Sicherheit beruht auf der totalen Selbstbehauptung des Ich, das sich dem Wagnis verweigert, aus sich herauszugehen und sich dem anderen anzuvertrauen. Dies ist geradezu die Probe für das Fehlen wahrer Liebe. Demgegenüber ist festzuhalten an einer Weise der Furcht, die mit der Liebe nicht nur vereinbar ist, sondern notwendig aus ihr folgt: der Furcht, den Geliebten zu verletzen, durch eigene Schuld die Grundlagen der Liebe zu zerstören. Liberalismus und Aufklärung wollen uns eine Welt ohne Furcht einreden; sie versprechen die totale Beseitigung jeder Art von Furcht. Sie möchten jedes Noch nicht, jede Angewiesenheit auf den anderen und deren innere Spannung austreiben, die aber doch wesentlich zu Hoffnung und Liebe gehört.“58
Die Theologie der Geschichte, wie sie Joseph Ratzinger entwirft, hier aber nur skizzenhaft wiedergegeben, erscheint in ihren Grundzügen eine Antwort auf den zeitgenössischen Pragmatismus der Selbstgefälligkeit und menschlicher Omnipotenzwünsche zu sein. Nicht der immerwährende Fortschritt ist die Triebkraft und das Ziel der Geschichte, sondern die Hand Gottes, der in und aus Liebe sein Reich in dieser Zeit aufrichtet, trotz und in allem Leid und Unrecht. Dabei sind die „Proportionen“ Gottes anders gesetzt, als es der Mensch selbst erwartet, doch im Glauben darf er wissen, daß Gott alles in seinem Erbarmen heimholen und versöhnen wird. Gegenüber der Unendlichkeit göttlichen Erbarmens erscheint der „Pelagianismus der Frommen“, die sich pharisäerhaft den Himmel gleichsam verdienen und erwerben wollen, wie ein Hohn auf die Voraussetzungslosigkeit der Liebe Gottes. 5. Ökumenische Perspektiven
Zahlreich sind Ratzingers Aktivitäten im Gespräch mit der evangelischen Kirche. Schon 1964 wurde er in den „Ökumenischen Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen“ berufen, seither war er ununterbrochen am ökumenischen Gespräch beteiligt. Zuletzt noch „rettete“ er die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre; als nämlich die Gespräche zwischen dem päpstlichen Einheitsrat unter der Leitung von Kardinal Cassidy und der Genfer Spitze des Lutherischen Weltbundes zu scheitern drohten, traf er sich inoffiziell in Bayern mit lutherischen Freunden und arbeitete die gemeinsame offizelle Feststellung aus, die von beiden Seiten am Reformationstag 1999 unterschrieben werden konnte.
Zwar hat sich Joseph Ratzinger nicht ausführlich mit der orthodoxen Theologie beschäftigt, wohl aber trifft er sich in seinen theologischen Anliegen auf vielfache Weise mit Grundaussagen östlicher Theologie. Daß es eine derartige Gemeinsamkeit im Grundanliegen gibt, ist alles andere als selbstverständlich, denn die Wege theologischen und geistlichen Lebens haben sich über die Jahrhunderte in Ost und West immer mehr differenziert. Yves Congar schreibt: „Wir sind zu verschiedenen Menschen geworden. Wir haben den gleichen Gott, aber wir stehen vor Ihm als verschiedene Menschen, können uns über die Art unseres Verhältnisses zu Ihm nicht einigen.“59 Das Dogma, das die Kirchen trennt, führte zu unterschiedlichen geistlichen und theologischen Wegen.60
Östliche Theologie ist mehr auf das Ziel christlichen Lebens ausgerichtet, nämlich die Gleichförmigkeit mit Christus im Heiligen Geist, während im Abendland vor allem der Wegcharakter des Glaubens bedacht wird. Daraus erklärt sich, daß es östlicher Theologie nicht so sehr um das Konzept der „Nachfolge Christi“ geht. Die Mystik der Nachfolge Christi, die im Abendland zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist der orientalischen Spiritualität fremd; diese läßt sich eher als Leben in Christus definieren. Das Leben in der Einheit des Leibes Christi verleiht dem Menschen alle notwendigen Voraussetzungen, um die Gnade des Heiligen Geistes zu erwerben, d.h. um am Leben der Heiligsten Dreifaltigkeit selbst teilzunehmen.61 Dieser Ansatz hat in der Begegnung von westlicher und östlicher Theologie eine aktuelle Bedeutung, wie nun anhand der Ausführungen Ratzingers aufzuzeigen ist.
Heinz Gstrein, der stellvertretende Leiter des Züricher Instituts „Glaube in der zweiten Welt“, zitiert ein Schreiben des Kardinals an den Metropoliten Damaskinos Papandreou in Genf vom 20. Februar 2001: „Lieber Bruder und Freund, wir beide leiden darunter, daß wir nicht miteinander Eucharistie feiern dürfen, und gerade das eint uns. Daß Du in diesem gemeinsamen Leiden und der darin verborgenen Freude der Hoffnung auf eine tiefere Einheit mir ganz nahe geblieben bist, ist der große Freundschaftsdienst vieler Jahrzehnte“62. Der „Stachel“ der Trennung unter Christen ist, daß sie gerade in dem, was Kirche ausmacht, nämlich in der Eucharistie, getrennt sind.
Nach der Begegnung Papst Pauls VI. mit Patriarch Athenagoras schien eine Eucharistiegemeinschaft mit der orthodoxen Kirche nahe gerückt zu sein; nicht anders verhielt es sich im Gespräch mit den „reformatorischen Gemeinschaften“, denn das II. Vatikanum löste einen ökumenischen Frühling aus, der auf eine baldige Kircheneinheit hoffen ließ. Doch momentan scheint das ökumenische Gespräch eher ins Stocken geraten zu sein. Worte der Enttäuschung und Resignation sind nicht zu überhören.
Als Kardinal Ratzinger zum 264. Nachfolger des heiligen Petrus als Bischof von Rom gewählt wurde, war die Reaktion der orthodoxen Kirchen äußerst positiv; dies gilt vom Moskauer Patriarchat der Russisch‑Orthodoxen über das Ökumenische Patriarchat von Konstantinopel und die griechisch‑orthodoxe Kirche bis zum koptisch‑orthodoxen Patriarchat in Ägypten. „Wir sind sehr glücklich über die Wahl von Papst Benedikt XVI.“, meinte der koptisch‑orthodoxe Bischof Barnaba El Suriani, der den koptischen Patriarchen Papst Shenuda III. bei der Amtseinführung des Heiligen Vaters vertrat. Es wurden hohe Erwartungen an den ökumenischen Dialog unter Papst Benedikt XVI. geäußert. Denn der Theologe Joseph Ratzinger hat sich vielen orthodoxen Theologen während seiner Tätigkeit als Professor, Bischof und Präfekt der Glaubenskongregation immer wieder als ein Freund und Kenner orthodoxer Theologie erwiesen. Man erinnert sich an die beiden Vorträge, die der damalige Professor Joseph Ratzinger 1974 und 1976 in Wien und Graz hielt. Dort griff er die Worte des Patriarchen Athenagoras vom 25. Juli 1967 auf, die dieser bei seiner Begegnung mit Papst Paul VI. geäußert hatte: „Und siehe, wir haben in unserer Mitte gegen jede menschliche Erwartung, den ersten von uns der Ehre nach, den ‚Vorsitzenden in der Liebe‘.“ Professor Ratzinger kommentiert im April 1974: „Es ist klar, daß der Patriarch damit nicht den ostkirchlichen Boden verläßt und sich nicht zu einem westlichen Jurisdiktionsprimat bekennt. Aber er stellt deutlich heraus, was der Osten über die Reihenfolge der an Rang und Recht gleichen Bischöfe der Kirche zu sagen hat, und es wäre nun doch der Mühe wert zu überlegen, ob dieses archaische Bekenntnis […] nicht doch als eine dem Keim der Sache genügende Sicht der Stellung Roms in der Kirche gewertet werden könnte.“ Was er hiermit konkret meint, legt Joseph Ratzinger bei seinem Vortrag am 6. Januar 1976 in Graz dar, wenn er die Maxime formuliert: „Rom muß vom Osten nicht mehr an Primatslehre fordern, als auch im ersten Jahrtausend formuliert und gelebt wurde.“63 An anderer Stelle fügt er hinzu: „Wer auf dem Boden der katholischen Theologie steht, kann gewiß nicht einfach die Primatslehre als null und nichtig erklären. Aber er kann andererseits unmöglich die Primatsgestalt des 19. und 20. Jahrhunderts für die einzig mögliche und allen Christen notwendige ansehen.“64
Bei seiner Amtseinführung betont Papst Benedikt XVI., daß er in seinem Pontifikat nicht eigene Ideen durchsetzen wolle, sondern seinen Weg gemeinsam mit der ganzen Kirche gehen möchte, und zwar im Hören auf Wort und Willen des Herrn. Es fällt auf, mit wie vielen Gesten und Worten Papst Benedikt XVI. durchscheinen läßt, wie sehr das ökumenische Gespräch sein besonderes Anliegen ist. In der „Messe zum Beginn des Petrusdienstes“ nimmt er erstmals in der Neuzeit wieder jenes mit fünf roten Kreuzen bestickte lange Pallium, das während des ersten Jahrtausends von den Päpsten getragen wurde, als Ost und Westkirche noch nicht getrennt waren. In seinem Wappen verzichtet er auf die Tiara und ersetzt sie durch eine Mitra. Wie will der neu gewählte Papst seinen eigenen Dienst im Gespräch mit der Ostkirche verstanden und ausgeübt sehen?
Schon seit den frühen Jahren seiner theologischen Arbeit als Professor beschäftigte sich Joseph Ratzinger mit dem Thema Ökumene und setzte sich in zahlreichen Kommissionen für die Suche nach der Einheit im Glauben ein.65 In seinem Buch „Einführung in das Christentum“ (1968) setzt er den Rahmen jeder ökumenischen Arbeit: „Die Kirche ist nicht von ihrer Organisation her zu denken, sondern die Organisation von der Kirche her zu verstehen. Aber zugleich ist deutlich, daß für die sichtbare Kirche die sichtbare Einheit mehr ist als ‚Organisation‘. Die konkrete Einheit des gemeinsamen, im Wort sich bezeugenden Glaubens und des gemeinsamen Tisches Jesu Christi gehört wesentlich zu dem Zeichen, welches die Kirche aufrichten soll in der Welt. Nur als ‚katholische‘, das heißt in der Vielheit dennoch sichtbar eine, entspricht sie der Forderung des Bekenntnisses. Sie soll in der zerrissenen Welt Zeichen und Mittel der Einheit sein, Nationen, Rassen und Klassen überschreiten und vereinen.“66 Ökumenische Arbeit darf nicht bei einer isolierten „Basis“ bzw. „Obrigkeit“ ansetzen: Eine ausgehandelte Einheit ist nur „Menschenwerk“67; theologische Konsenseinigungen bleiben auf der menschlichen bzw. wissenschaftlichen Ebene.
Nach Joseph Ratzinger ist im ökumenischen Gespräch zunächst und vor allem nach „der Vertretbarkeit des Getrenntbleibens“ zu fragen, „denn nicht die Einheit bedarf der Rechtfertigung, sondern die Trennung“68. Dabei unterscheidet er zwischen menschlichen Trennungen und theologischen Spaltungen. Es kann eine Verschiedenheit geben, die das Wesen der Kirche nicht beeinträchtigt; hier gilt es, „das Miteinander in der Vielheit gewachsener geschichtlicher Formen leben zu lernen“. Positiv anzustreben ist eine „Einheit durch Vielfalt, durch Verschiedenheit“69, wobei gerade die Verschiedenheit einen neuen „Reichtum des Hörens und Verstehens“ erschließen kann. Sobald einer Spaltung das Gift der Feindseligkeit genommen wird und man sich gegenseitig annimmt, führt dieser Weg zur Erfahrung einer „felix culpa“, „auch bevor sie ganz geheilt wird“70: „Der harte Kern der Trennung ist erst da gegeben, wo ein oder mehrere Partner gewiß sind, daß sie nicht ihre eigenen Ideen verteidigen, sondern zu dem stehen, was sie aus der Offenbarung empfangen haben und daher nicht manipulieren können.“71
Ratzingers Konzept im ökumenischen Gespräch unterscheidet sich grundlegend von vielem, was in der Annäherung der Christen derzeit allgemein üblich ist. Nach seiner Ansicht läßt sich eine Vereinigung der Christen nicht mit Maximalforderungen erreichen, es bedarf vielmehr der Wahrheit und Redlichkeit auf dem Weg zu ihr.72 Über die Wahrheit läßt sich nicht diskutieren73, debattieren und abstimmen, ihr kann man nur dienen und die Ehre geben: „Wahrheit ist keine Mehrheitsfrage. Sie ist oder sie ist nicht. Deswegen sind Konzilien nicht verbindlich, weil eine Mehrheit von qualifizierten Vertretern etwas beschlossen hat. […] Konzilien beruhen auf dem Prinzip der moralischen Einmütigkeit, und die wiederum erscheint nicht als eine besonders hohe Mehrheit. Nicht der Konsens begründet die Wahrheit, sondern die Wahrheit den Konsens: Die Einmütigkeit so vieler Personen ist immer als etwas menschlich Unmögliches angesehen worden. Wenn sie auftritt, zeigt sich darin die Überwältigung durch die Wahrheit selbst. Die Einmütigkeit ist nicht Grund der Verbindlichkeit, sondern das Zeichen der erscheinenden Wahrheit, und aus ihr fließt die Verbindlichkeit.“74 Das ökumenische Gespräch verlangt mehr als kirchenpolitische Verhandlungen und einen äußeren Konsens, betont Joseph Ratzinger: „Da aber der Glaube nicht eine bloße Setzung menschlichen Denkens ist, sondern Frucht einer Gabe, kann die Gemeinsamkeit auch letztlich nicht aus einer Operation des Denkens kommen, sondern wiederum nur geschenkt werden.“75
Arbeit in der Ökumene muß sich vom Prinzip des „Unverfügbaren“ leiten lassen. Durch eine Einigung in Basissätzen ergibt sich noch keine Vereinigung der Christen; eine von Menschen ausgehandelte Einheit „könnte logischerweise nur eine Angelegenheit iuris humani sein. Sie würde damit die in Joh 17 gemeinte theologische Einheit überhaupt nicht berühren“76. Das ökumenische Mühen verlangt nicht nur Kompromißfähigkeit und Verhandlungstalent, es setzt „die eigentlich religiöse Ebene“ von Gebet und Buße voraus, denn es ist primär ein geistliches, weil geistgewirktes Vorhaben.
Glaube und Vereinigung im Glauben sind keine Sache des Menschen, der sie hervorrufen und bewerkstelligen könnte 77, vielmehr gründen sie im Gebet Jesu für seine Kirche und ihre Einheit. Joseph Ratzinger betont, „daß wir die Stunde nicht wissen und auch nicht festlegen können, wann und wie die Einheit zustande kommt“78; sie ist allein Gottes Sache.79 Bis Gott selbst die Einheit der Christen bewirkt, gilt es, im ökumenischen Gespräch und in der Annäherung der Christen „dem anderen nichts aufdrängen zu wollen, was ihn ‑ noch ‑ im Kern seiner christlichen Identität bedroht“80: „Katholiken sollten nicht versuchen, Protestanten zur Anerkennung des Papsttums und ihres Verständnisses von apostolischer Sukzession zu drängen. […] Umgekehrt sollten Protestanten davon ablassen, von ihrem Abendmahlsverständnis her die katholische Kirche zur Interkommunion zu drängen, da nun einmal für uns das doppelte Geheimnis des Leibes Christi ‑ Leib Christi als Kirche und Leib Christi als sakramentale Gabe ‑ ein einziges Sakrament ist, und die Leibhaftigkeit des Sakramentes aus der Leibhaftigkeit der Kirche herauszureißen das Zertreten der Kirche und des Sakraments in einem bedeutet.“81
Vor allen praktischen Bemühungen und schon erreichten Übereinstimmungen im ökumenischen Gespräch ist nach dem zu fragen, was Gott selbst der Kirche in der Annäherung mit den anderen Kirchen sagen und zeigen will. Ja, es gilt, nach dem tieferen Sinn der Trennung und Spaltung zu fragen. Joseph Ratzinger verweist auf 1 Kor 11,19, indem er diese Stelle im Sinne Augustins auslegt: „Spaltungen müssen sein“. Der biblische Begriff „dei“ meint in diesem Zusammenhang ein göttliches Handeln bzw. eine eschatologische Notwendigkeit: „Auch wenn Spaltungen zuallererst menschliches Werk und menschliche Schuld sind, so gibt es in ihnen doch auch eine Dimension, die einem göttlichen Verfügen entspricht. Darum können wir sie auch nur bis zu einem gewissen Punkt hin durch Buße und Bekehrung aufarbeiten; wann es aber so weit ist, daß wir dieses Spalts nicht mehr bedürfen und daß das ‚Muß‘ wegfällt, das entscheidet der richtende und vergebende Gott selbst ganz allein.“82 Um „durch Verschiedenheit Einheit zu finden“, gilt es, „in den Spaltungen das Fruchtbare anzunehmen, sie zu entgiften und gerade von der Verschiedenheit Positives zu empfangen ‑ natürlich in der Hoffnung, daß am Ende die Spaltung überhaupt aufhört, Spaltung zu sein und nur noch ‚Polarität‘ ohne Widerspruch ist“83. So gibt es für die deutsche Kirche, wie Joseph Ratzinger bemerkt, durchaus ein Positives im Protestantismus „mit seiner Liberalität und seiner Frömmigkeit“, nicht zuletzt „mit seinem hohen geistigen Anspruch“84.
Welche Konzepte für den Weg zur Einigung mit der Ostkirche lassen sich bei Joseph Ratzinger herausarbeiten? Seiner Meinung nach beruht die Trennung von 1054 vor allem auf der Verschiedenheit der Entwicklungen in Ost und West. Im Westen wird die Kirche immer stärker juristisch konzipiert; das Dogma von 1870 stellt gleichsam den Höhepunkt dieser Entwicklung dar. Während die Ostkirche als ein Gefüge bischöflich geleiteter Ortskirchen erscheint, geht – wenigstens auf den ersten Blick – genau dies dem Westen verloren, was der Osten als eine Aufgabe des Grundgefüges der Kirche überhaupt deutet.85 Dennoch, wie die Kirche des Ostens bleibt auch die des Westens dem Gehalt und der Gestalt der Väterkirche ungebrochen treu; in Rom besteht keine andere Kirche gegenüber jener im ersten Jahrtausend, also jener Zeit, in der man gemeinsam Eucharistie feierte und eine Kirche war.86 Der Osten darf die Entwicklung der Westkirche im zweiten Jahrtausend nicht als häretisch erklären, wie umgekehrt der Westen die Kirche des Ostens in der Gestalt anerkennen muß, „die sie sich bewahrt hat“87.
Noch ein Punkt sei angeführt, der für das weitere Gespräch mit der Orthodoxie entscheidend werden kann. Bischof Hilarion Alfejew von der russisch-orthodoxen Diözese Wien führt hierzu aus: „Soweit ich weiß, haben die Orthodoxen noch nicht adäquat auf die Einladung von Papst Johannes Paul II. reagiert, ein für sie annehmbares Modell des universalen Primats zu erarbeiten“; statt die katholische Sicht des Primats nur zu kritisieren, muß die Orthodoxie eine eigene Auffassung in der Frage des Primats entwickeln, die für die katholische Kirche überzeugend ist.88 Von römischer Seite muß deutlich gemacht werden, daß es beim Papsttum nicht bloß um eine Rechtsstellung geht, die über die sakramentale Ordnung gesetzt wurde; vielmehr muß für die Orthodoxie sichtbar gemacht werden, daß im wirklichen Leben der Kirche und im gültigen Kern ihrer Verfassung das sakramentale Gefüge immer lebendig und in seiner Einheit mit dem Petrusamt das Tragende war.89 Hier hat das Gespräch mit der Ostkirche anzusetzen: Über die theologischen Argumente und Klärungen hinaus bedarf es der grundlegenderen Haltung des Gebets und des gegenseitigen Verstehens und Annehmens. In diesem Sinn muß auch die Feststellung Joseph Ratzinger verstanden werden: „Eine Kircheneinheit zwischen Ost und West ist theologisch grundsätzlich möglich, aber spirituell noch nicht genügend vorbereitet und daher praktisch noch nicht reif.“90
Spirituell reif ist die Zeit für eine Vereinigung der Christen erst, wenn sie aus einer Einheit in der Liebe kommt. Gewiß, es wird Verhandlungen, Gespräche und Kommissionen geben müssen, aber die Christen werden nicht auf rein administrativem Weg zueinander finden, sondern nur aus der Feststellung, daß sie – trotz und in aller Vielfalt und Unterschiedenheit – im Glauben an Christus doch immer schon innerlich eins sind bzw. geblieben sind und es in der Feier des Glaubens und der Sakramente und in der Einheit des Gebets und der Ausübung der Liebe immer mehr werden können |